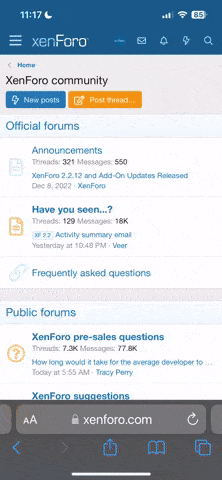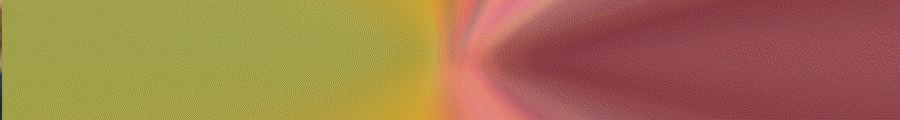collombo
MyBoerse.bz Pro Member
Rechtsextreme Drohschreiben: Weitere verdächtige Abfragen über Polizeicomputer !
Neue Ermittlungen zu Drohschreiben des NSU 2.0: Nach Recherchen von WDR und SZ sollen auch in Berlin und Hamburg persönliche Daten von Betroffenen über Polizeicomputer abgefragt worden sein.
Mehr als 80 Drohschreiben, unterzeichnet mit "NSU 2.0", sind in den vergangenen Jahren an Politikerinnen, eine Anwältin, Künstlerinnen und Aktivistinnen verschickt worden.
Die betroffenen Personen, darunter die Frankfurter Juristin Seda Basay-Yildiz, der "Welt-"Journalist Deniz Yücel und die hessische Linken-Politikerin Janine Wissler, wurden darin nicht nur beleidigt und verunglimpft - sondern ihnen wurde auch mit dem Tod gedroht.
In einigen Fällen enthielten die E-Mails, Faxe und SMS auch persönliche Daten wie Meldeadressen oder Namen und Geburtsdaten von Familienangehörigen.
Der Verdacht besteht, dass die Informationen über polizeiliche Systeme abgefragt wurden.
Denn in der Vergangenheit waren bereits verdächtige Abfragen über Polizeicomputer in Frankfurt am Main und in Wiesbaden festgestellt worden.
Mehrere Polizisten waren daraufhin vom Dienst suspendiert worden.
Wer die Drohschreiben tatsächlich verschickt hat, ist allerdings bis heute unklar.
Verdächtig Anfragen auch in Berlin und Hamburg
Nach Recherchen von WDR und "Süddeutscher Zeitung" (SZ) haben die Ermittlungen des hessischen Landeskriminalamtes (LKA) zum Bedrohungssachverhalt NSU 2.0 kürzlich ergeben, dass nicht nur in Hessen verdächtige Abfragen über Polizeicomputer erfolgten, sondern wohl auch in Berlin und Hamburg.
Ein dienstlicher Anlass für die Abfragen soll dabei zumindest zunächst nicht erkennbar gewesen sein.
In Berlin sollen Anfang März 2019 persönliche Daten der Kabarettistin Idil Baydar abgefragt worden sein - und zwar zeitnah zu einer Abfrage an einem Polizeicomputer im 4. Polizeirevier in Wiesbaden.
Kurz darauf erhielt die Künstlerin, die in Frankfurt und Berlin lebt, Drohschreiben des NSU 2.0.
In Hamburg wiederum stellte die Polizei fest, dass die Daten der "taz"-Kolumnistin Hengameh Yaghoobifarah in polizeilichen System aufgerufen worden waren.
Auch sie erhielt kurz darauf eine Drohemail, die mit NSU 2.0 unterzeichnet waren.
Behörden prüfen noch
"Es ist zutreffend, dass es im Zusammenhang mit der genannten Journalistin Datenabfragen bei der Polizei Hamburg gegeben hat", teilte ein Sprecher der Hamburger Polizei mit.
Ob diese Abfragen berechtigt oder unberechtigt erfolgten, werde aktuell noch geprüft.
Im Fall von Idil Baydar wollte sich die Berliner Polizei nicht zu der verdächtigen Abfrage äußern und verwies auf die Frankfurter Staatsanwaltschaft.
Eine Sprecherin dort teilte mit, "aus ermittlungstaktischen Gründen" könne man derzeit keine Angaben machen.
"Ich hatte schon mal die Befürchtung, dass die Drohschreiben auch mit Berlin zu tun haben", sagt die Kabarettistin Idil Baydar ("Jilet Ayşe") auf Anfrage.
In einer Droh-SMS sei einmal auf ein Plakat angespielt worden, das damals nur in Berlin zu sehen gewesen sei.
"Ich habe das der Polizei in Berlin auch gesagt: Schaut mal, wer so etwas schreibt, der muss eigentlich in den letzten Tagen in Berlin unterwegs gewesen sein.
Aber da gab es keine Antwort.
Die sprechen ja nicht mit mir.
Mir wird nichts gesagt, weil es angeblich laufende Ermittlungen sind."
Hunderte Verfahren gegen Polizisten
Unberechtigte Datenabfragen durch Polizisten gibt es immer wieder, wie jüngst eine Umfrage der "Welt am Sonntag" bei den Innenministerien und Datenschutzbeauftragten der Bundesländer sowie des Bundes ergab.
Mehr als 400 Ordnungswidrigkeits-, Straf- und Disziplinarverfahren wurden demnach seit 2018 wegen solcher Datenabfragen eingeleitet.
In Hessen ermittelt das LKA seit zwei Jahren im Fall NSU 2.0 - bislang jedoch ohne konkrete Erfolge.
Der oder die Urheber der Drohschreiben nutzen häufig Verschlüsselungstechnologien und Anonymisierungsdienste, um ihre Identität zu verschleiern.
Daher bezog das LKA auch Cybercrime-Experten und Fachleute des Bundeskriminalamtes (BKA) in die Ermittlungen mit ein.
Es wurden linguistische Gutachten erstellt und Fallanalytiker eingesetzt, um ein Täterprofil zu erarbeiten.
Drohmails teilweise über ausländische Server versandt
Zudem gab es Rechtshilfeersuchen an ausländische Behörden.
Unter anderem nach Russland und Frankreich.
Mehrere der Drohschreiben sollen von einem Nutzerkonto des russischen E-Mail-Anbieters Yandex verschickt worden sein.
Bislang soll es allerdings keinerlei brauchbare Informationen von Seiten russischer Behörden zum mutmaßlichen Nutzer dieser E-Mail-Adresse gegeben haben.
Die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main hatte den Generalbundesanwalt in diesem Jahr um Übernahme des Verfahrens gebeten.
In Karlsruhe aber sieht man sich bislang nicht zuständig - der Generalbundesanwalt ermittelt nicht bei Bedrohung oder Nötigung.
Die bisherigen Ermittlungen hätten "keine zureichenden tatsächlichen Anhaltspunkte für Sachverhalte ergeben, auf deren Grundlage die Bundesanwaltschaft die Ermittlungen übernehmen und die Strafverfolgung in eigener Zuständigkeit durchführen dürfte", so ein Sprecher.
Bisher noch keine Verurteilungen
Im Zuge der NSU 2.0-Ermittlungen war auch eine Chatgruppe von Frankfurter Polizeibeamten bekannt geworden, in der rechtsextreme, rassistische und antisemitische Inhalte verbreitet worden sein sollen.
Mehrere Polizeibeamte einer Frankfurter Wache waren daraufhin vom Dienst suspendiert worden.
Ein Polizist war im Frühjahr 2019 zeitweise als Tatverdächtiger ins Visier der Ermittler geraten und wurde umfangreich überwacht.
Der Verdacht aber erhärtete sich nicht.
Im Juli dann führt eine Spur nach Bayern.
Ein Ehepaar aus Landshut wurde vorübergehend festgenommen und die Wohnung durchsucht.
Der 63-jährige ehemalige Polizist und seine Frau standen im Verdacht für mehrere Drohmails mit beleidigenden und volksverhetzenden Inhalten verantwortlich zu sein.
Ein Vertreter der Frankfurter Staatsanwaltschaft sagte vor kurzem im Rechtsausschuss des Landtages, man könne davon ausgehen, dass es sich womöglich um Trittbrettfahrer handele.
Der ehemalige Beamte, der in der Vergangenheit auch Beiträge auf rechten Internetseiten publiziert hatte, wies die Vorwürfe auf Nachfrage zurück.
Inzwischen soll aber auch die Generalstaatsanwaltschaft München gegen den Mann ermitteln, da bei der Durchsuchung mehrere illegale Schusswaffen gefunden worden sein sollen.
Quelle: tagesschau
Neue Ermittlungen zu Drohschreiben des NSU 2.0: Nach Recherchen von WDR und SZ sollen auch in Berlin und Hamburg persönliche Daten von Betroffenen über Polizeicomputer abgefragt worden sein.
Mehr als 80 Drohschreiben, unterzeichnet mit "NSU 2.0", sind in den vergangenen Jahren an Politikerinnen, eine Anwältin, Künstlerinnen und Aktivistinnen verschickt worden.
Die betroffenen Personen, darunter die Frankfurter Juristin Seda Basay-Yildiz, der "Welt-"Journalist Deniz Yücel und die hessische Linken-Politikerin Janine Wissler, wurden darin nicht nur beleidigt und verunglimpft - sondern ihnen wurde auch mit dem Tod gedroht.
In einigen Fällen enthielten die E-Mails, Faxe und SMS auch persönliche Daten wie Meldeadressen oder Namen und Geburtsdaten von Familienangehörigen.
Der Verdacht besteht, dass die Informationen über polizeiliche Systeme abgefragt wurden.
Denn in der Vergangenheit waren bereits verdächtige Abfragen über Polizeicomputer in Frankfurt am Main und in Wiesbaden festgestellt worden.
Mehrere Polizisten waren daraufhin vom Dienst suspendiert worden.
Wer die Drohschreiben tatsächlich verschickt hat, ist allerdings bis heute unklar.
Verdächtig Anfragen auch in Berlin und Hamburg
Nach Recherchen von WDR und "Süddeutscher Zeitung" (SZ) haben die Ermittlungen des hessischen Landeskriminalamtes (LKA) zum Bedrohungssachverhalt NSU 2.0 kürzlich ergeben, dass nicht nur in Hessen verdächtige Abfragen über Polizeicomputer erfolgten, sondern wohl auch in Berlin und Hamburg.
Ein dienstlicher Anlass für die Abfragen soll dabei zumindest zunächst nicht erkennbar gewesen sein.
In Berlin sollen Anfang März 2019 persönliche Daten der Kabarettistin Idil Baydar abgefragt worden sein - und zwar zeitnah zu einer Abfrage an einem Polizeicomputer im 4. Polizeirevier in Wiesbaden.
Kurz darauf erhielt die Künstlerin, die in Frankfurt und Berlin lebt, Drohschreiben des NSU 2.0.
In Hamburg wiederum stellte die Polizei fest, dass die Daten der "taz"-Kolumnistin Hengameh Yaghoobifarah in polizeilichen System aufgerufen worden waren.
Auch sie erhielt kurz darauf eine Drohemail, die mit NSU 2.0 unterzeichnet waren.
Behörden prüfen noch
"Es ist zutreffend, dass es im Zusammenhang mit der genannten Journalistin Datenabfragen bei der Polizei Hamburg gegeben hat", teilte ein Sprecher der Hamburger Polizei mit.
Ob diese Abfragen berechtigt oder unberechtigt erfolgten, werde aktuell noch geprüft.
Im Fall von Idil Baydar wollte sich die Berliner Polizei nicht zu der verdächtigen Abfrage äußern und verwies auf die Frankfurter Staatsanwaltschaft.
Eine Sprecherin dort teilte mit, "aus ermittlungstaktischen Gründen" könne man derzeit keine Angaben machen.
"Ich hatte schon mal die Befürchtung, dass die Drohschreiben auch mit Berlin zu tun haben", sagt die Kabarettistin Idil Baydar ("Jilet Ayşe") auf Anfrage.
In einer Droh-SMS sei einmal auf ein Plakat angespielt worden, das damals nur in Berlin zu sehen gewesen sei.
"Ich habe das der Polizei in Berlin auch gesagt: Schaut mal, wer so etwas schreibt, der muss eigentlich in den letzten Tagen in Berlin unterwegs gewesen sein.
Aber da gab es keine Antwort.
Die sprechen ja nicht mit mir.
Mir wird nichts gesagt, weil es angeblich laufende Ermittlungen sind."
Hunderte Verfahren gegen Polizisten
Unberechtigte Datenabfragen durch Polizisten gibt es immer wieder, wie jüngst eine Umfrage der "Welt am Sonntag" bei den Innenministerien und Datenschutzbeauftragten der Bundesländer sowie des Bundes ergab.
Mehr als 400 Ordnungswidrigkeits-, Straf- und Disziplinarverfahren wurden demnach seit 2018 wegen solcher Datenabfragen eingeleitet.
In Hessen ermittelt das LKA seit zwei Jahren im Fall NSU 2.0 - bislang jedoch ohne konkrete Erfolge.
Der oder die Urheber der Drohschreiben nutzen häufig Verschlüsselungstechnologien und Anonymisierungsdienste, um ihre Identität zu verschleiern.
Daher bezog das LKA auch Cybercrime-Experten und Fachleute des Bundeskriminalamtes (BKA) in die Ermittlungen mit ein.
Es wurden linguistische Gutachten erstellt und Fallanalytiker eingesetzt, um ein Täterprofil zu erarbeiten.
Drohmails teilweise über ausländische Server versandt
Zudem gab es Rechtshilfeersuchen an ausländische Behörden.
Unter anderem nach Russland und Frankreich.
Mehrere der Drohschreiben sollen von einem Nutzerkonto des russischen E-Mail-Anbieters Yandex verschickt worden sein.
Bislang soll es allerdings keinerlei brauchbare Informationen von Seiten russischer Behörden zum mutmaßlichen Nutzer dieser E-Mail-Adresse gegeben haben.
Die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main hatte den Generalbundesanwalt in diesem Jahr um Übernahme des Verfahrens gebeten.
In Karlsruhe aber sieht man sich bislang nicht zuständig - der Generalbundesanwalt ermittelt nicht bei Bedrohung oder Nötigung.
Die bisherigen Ermittlungen hätten "keine zureichenden tatsächlichen Anhaltspunkte für Sachverhalte ergeben, auf deren Grundlage die Bundesanwaltschaft die Ermittlungen übernehmen und die Strafverfolgung in eigener Zuständigkeit durchführen dürfte", so ein Sprecher.
Bisher noch keine Verurteilungen
Im Zuge der NSU 2.0-Ermittlungen war auch eine Chatgruppe von Frankfurter Polizeibeamten bekannt geworden, in der rechtsextreme, rassistische und antisemitische Inhalte verbreitet worden sein sollen.
Mehrere Polizeibeamte einer Frankfurter Wache waren daraufhin vom Dienst suspendiert worden.
Ein Polizist war im Frühjahr 2019 zeitweise als Tatverdächtiger ins Visier der Ermittler geraten und wurde umfangreich überwacht.
Der Verdacht aber erhärtete sich nicht.
Im Juli dann führt eine Spur nach Bayern.
Ein Ehepaar aus Landshut wurde vorübergehend festgenommen und die Wohnung durchsucht.
Der 63-jährige ehemalige Polizist und seine Frau standen im Verdacht für mehrere Drohmails mit beleidigenden und volksverhetzenden Inhalten verantwortlich zu sein.
Ein Vertreter der Frankfurter Staatsanwaltschaft sagte vor kurzem im Rechtsausschuss des Landtages, man könne davon ausgehen, dass es sich womöglich um Trittbrettfahrer handele.
Der ehemalige Beamte, der in der Vergangenheit auch Beiträge auf rechten Internetseiten publiziert hatte, wies die Vorwürfe auf Nachfrage zurück.
Inzwischen soll aber auch die Generalstaatsanwaltschaft München gegen den Mann ermitteln, da bei der Durchsuchung mehrere illegale Schusswaffen gefunden worden sein sollen.
Quelle: tagesschau