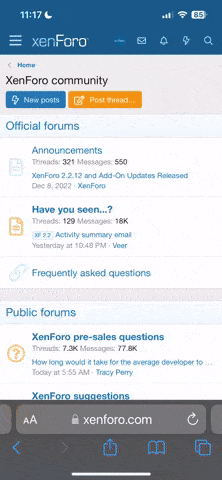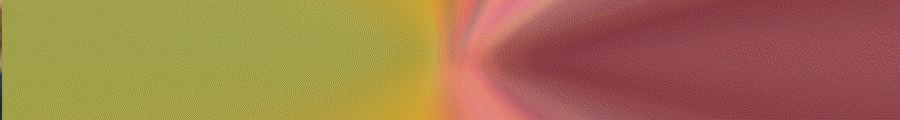collombo
MyBoerse.bz Pro Member
Putin unterschreibt verlängerten Abrüstungsvertrag mit USA !
In wenigen Tage wäre der Abrüstungsvertrag zwischen Russland und den USA abgelaufen.
Nach der Einigung mit US-Präsident Joe Biden unterzeichnete Wladimir Putin nun das entsprechende Gesetz.
Russlands Präsident Wladimir Putin hat ein Gesetz zur Verlängerung des letzten großen atomaren Abrüstungsvertrags mit den USA unterzeichnet.
Das teilte der Kreml am Freitagabend mit.
Die Staatsduma und der Föderationsrat hatten bereits am Mittwoch das Gesetz verabschiedet, wonach das New-Start-Abkommen über die Begrenzung der Nuklearwaffen der beiden größten Atommächte bis 2026 weitergelten soll.
Putin warnte immer wieder vor einem Wettrüsten
Putin hatte die Verlängerung zuvor als zweifelsfreien Schritt in die richtige Richtung bezeichnet.
Er hatte immer wieder vor einem kostspieligen neuen Wettrüsten gewarnt, sollte der New-Start-Vertrag platzen.
Putin und der neue US-Präsident Joe Biden hatten sich auf die Verlängerung des Abkommens geeinigt, das sonst in wenigen Tagen ausgelaufen wäre.
Das am 5. Februar 2011 in Kraft getretene Abkommen begrenzt die Nukleararsenale Russlands und der USA auf je 800 Trägersysteme und 1550 einsatzbereite Atomsprengköpfe.
Es war für eine Laufzeit von zehn Jahren geschlossen worden und sah die Möglichkeit einer Verlängerung vor.
Im Falle einer Nichtverlängerung hätte es erstmals seit Jahrzehnten kein Abkommen mehr gegeben, das dem Bestand strategischer Atomwaffen Grenzen setzt.
Russland und die USA besitzen zusammen rund 90 Prozent der weltweiten Atomwaffen.
In wenigen Tage wäre der Abrüstungsvertrag zwischen Russland und den USA abgelaufen.
Nach der Einigung mit US-Präsident Joe Biden unterzeichnete Wladimir Putin nun das entsprechende Gesetz.
Russlands Präsident Wladimir Putin hat ein Gesetz zur Verlängerung des letzten großen atomaren Abrüstungsvertrags mit den USA unterzeichnet.
Das teilte der Kreml am Freitagabend mit.
Die Staatsduma und der Föderationsrat hatten bereits am Mittwoch das Gesetz verabschiedet, wonach das New-Start-Abkommen über die Begrenzung der Nuklearwaffen der beiden größten Atommächte bis 2026 weitergelten soll.
Putin warnte immer wieder vor einem Wettrüsten
Putin hatte die Verlängerung zuvor als zweifelsfreien Schritt in die richtige Richtung bezeichnet.
Er hatte immer wieder vor einem kostspieligen neuen Wettrüsten gewarnt, sollte der New-Start-Vertrag platzen.
Putin und der neue US-Präsident Joe Biden hatten sich auf die Verlängerung des Abkommens geeinigt, das sonst in wenigen Tagen ausgelaufen wäre.
Das am 5. Februar 2011 in Kraft getretene Abkommen begrenzt die Nukleararsenale Russlands und der USA auf je 800 Trägersysteme und 1550 einsatzbereite Atomsprengköpfe.
Es war für eine Laufzeit von zehn Jahren geschlossen worden und sah die Möglichkeit einer Verlängerung vor.
Im Falle einer Nichtverlängerung hätte es erstmals seit Jahrzehnten kein Abkommen mehr gegeben, das dem Bestand strategischer Atomwaffen Grenzen setzt.
Russland und die USA besitzen zusammen rund 90 Prozent der weltweiten Atomwaffen.