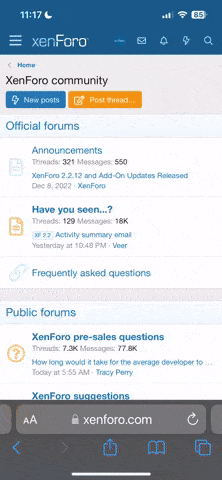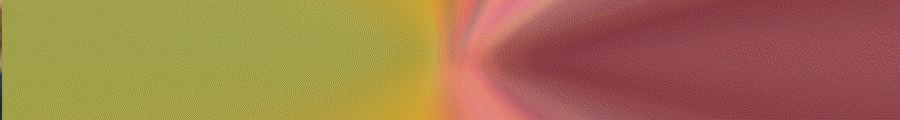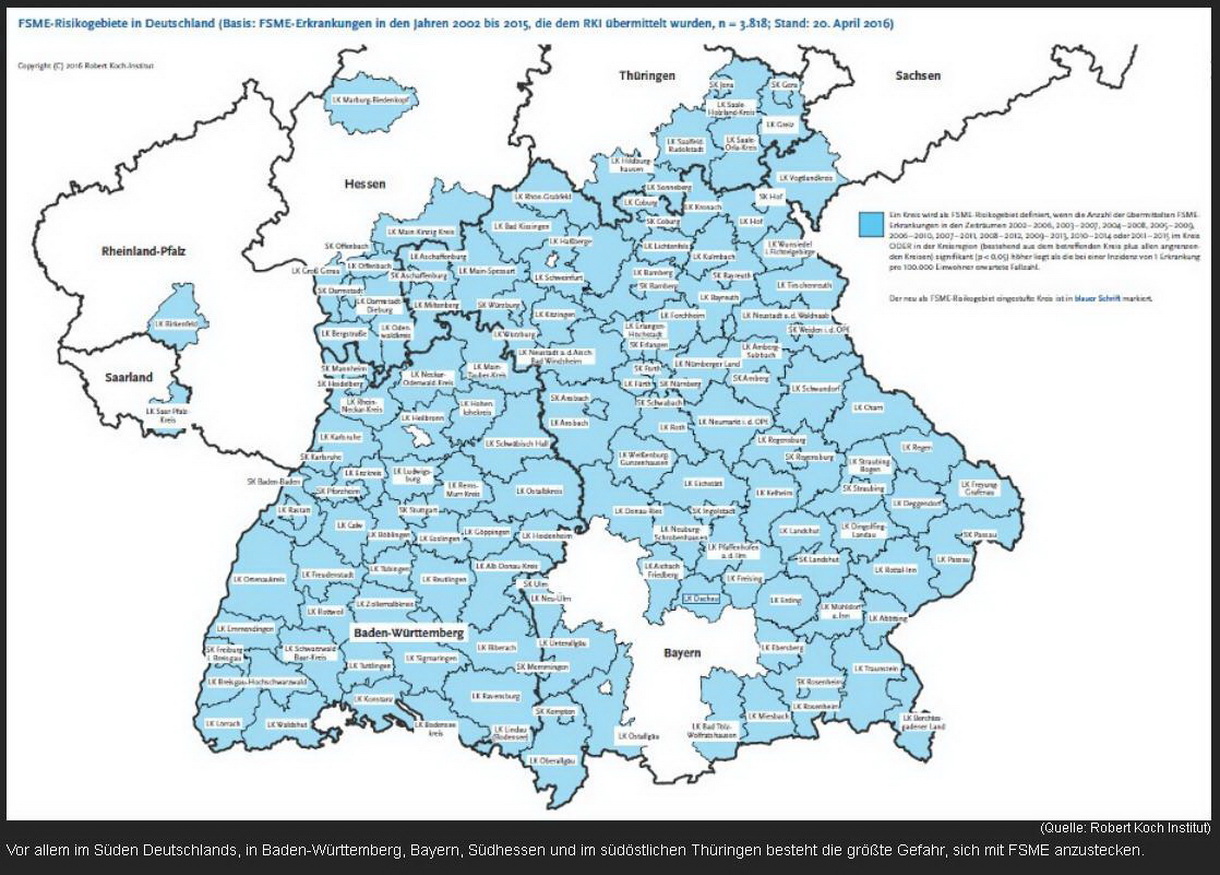Wie gefährlich ist elektromagnetische Strahlung wirklich ?
Sendemasten, Handys, WLAN-Router – elektromagnetische Strahlung umgibt uns täglich.
Über Gesundheits-Risiken wird heftig gestritten.
Berlin. "Möglicherweise krebserregend".
2011 verhängte die Weltgesundheitsorganisation (WHO) dieses Urteil über die sogenannte Handystrahlung – elektromagnetische Wellen, die von Mobiltelefonen ausgehen.
Neben WLAN-Routern, Hochspannungsmasten und vielen weiteren Quellen gesellten sich Handystrahlen damit zu den angeblichen Verursachern des Phänomens "Elektrosmog".
Doch was ist das überhaupt?
Ist er wirklich gefährlich oder nur Ergebnis einer Verschwörungstheorie?
Experten sind sich uneinig, Studien liefern bislang kaum aussagekräftige Ergebnisse.
Was ist Elektrosmog?
Das Wort Smog, bestehend aus smoke und fog (Rauch und Nebel), bezeichnet gemeinhin eine Luftverschmutzung durch Emissionen.
Verursacher der "Elektro-Verschmutzung" sollen elek*tromagnetische Wellen sein.
Doch dieser Begriff erschließt ein weites Feld: Röntgenstrahlen, Radiowellen, Wechselstrom und Radar gehören zum elek*tromagnetischen Spektrum.
Ebenso das sichtbare Licht, egal ob von Kerzen, Hochleistungsscheinwerfern oder der Sonne produziert.
Der "Smog" soll allerdings nicht von ionisierender Strahlung ausgehen, etwa Röntgen- oder Gammastrahlung, die erwiesenermaßen genug Energie besitzt, um DNA-Moleküle zu zerstören.
Es geht vielmehr um die nichtionisierende Strahlung: Mikrowellen von WLAN, Mobilfunk, Bluetooth und Wellen von Stromkabeln, elektrischen Geräten oder Hochspannungsleitungen.
Was sind die Befürchtungen?
Obwohl es kaum belastbare Erkenntnisse zu Elektrosmog gibt, ist die Sorge, die aus unzähligen Internetforen und Blogs spricht, groß.
Menschen suchen nach Zusammenhängen zwischen Mobilfunkmasten und plötzlich auftretenden Krankheiten, nach Verteilungsmustern bestimmter Symptome, nach Erklärungen für Burn-out oder Schlafstörungen.
Sie tauschen sich darüber aus, ob Pflanzen elektromagnetische Strahlung abschirmen können (nein), ob sie das Grundstück neben einer Transformatorstation besser nicht kaufen sollen (kommt drauf an), ob Batterien in Armbanduhren gefährlich strahlen (nein).
Sie lassen sich strahlenabsorbierende Tapeten, Kleidung und Wandfarbe andrehen.
Die verhärteten Fronten zwischen Wissenschaftlern, die "Elektrosmog" für gefährlich halten und denen, die das Gerede darüber als Unsinn verurteilen, tun ihr Übriges.
Warum es kaum Erkenntnisse gibt
"Die bestehenden wissenschaftlichen Unsicherheiten über die biologischen Wirkungen der elektromagnetischen Felder des Mobilfunks werden oft als Beweis der Schädlichkeit interpretiert", schreibt das Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) und mogelt sich damit an eindeutigen Aussagen vorbei.
Hunderte Studien, von Tierversuchen über statistische Erhebungen von Fallzahlen bestimmter Krankheiten bis hin zu Befragungen von Krebspatienten, haben sich bereits mit den potenziellen Risiken und Gefahren durch die nichtionisierende elektromagnetische Strahlung befasst – und kamen zu den unterschiedlichsten Ergebnissen, die wiederum auf unterschiedlichste Weise interpretiert wurden.
Das Problem: Mal sind die Fallzahlen zu niedrig, um Aussagekraft zu haben, mal lassen sich andere Faktoren als Ursachen nicht ausschließen.
Was sich belegen lässt
Tatsächlich bewiesen sind bislang nur thermische Effekte, wie man sie spürt, wenn man lange Zeit mit dem Handy am Ohr telefoniert hat.
Da der Körper seinen Wärmehaushalt normalerweise gut ausgleichen kann, ist die Gefahr schädlicher Effekte hier gering.
Lediglich Augen, Gehirn und Hoden gelten als besonders wärmeempfindlich: "Mit Auswirkungen auf die Gesundheit ist dann zu rechnen, wenn bestimmte Schwellenwerte überschritten werden und die Wärmeregulierung des Körpers gestört ist", heißt es beim BfS.
"Soweit sind die Erkenntnisse durch reproduzierbare Experimente belegt", sagt Metin Tolan, Professor für Experimentelle Physik an der Technischen Universität Dortmund.
Besagte Schwellenwerte orientieren sich daher an möglichen Gefahren durch Wärmestrahlung.
Wenn aber die These vom schädlichen Elektrosmog stimmen sollte, würden schon wesentlich geringere Strahlungsmengen, die längst nicht zur spürbaren Erwärmung einzelner Körperteile führen, ein Gefahrenpotenzial darstellen.
Die Datenlage jedoch ist dürftig.
Als zuverlässig gilt eine recht aktuelle Erkenntnis aus dem Tierversuch: Handystrahlung kann demnach zwar nicht die Entstehung eines Hirntumors, aber das Wachstum eines bereits bestehenden Tumors fördern.
Das zumindest ergab ein Experiment des Biologen Prof. Alexander Lerchl von der Jacobs University Bremen, der sich zuvor stets als Gegner derartiger Zusammenhänge positioniert hatte.
Ebenfalls anerkannt ist eine epidemiologische Studie, die ein erhöhtes Leukämierisiko bei Kindern, welche in unmittelbarer Nähe von Hochspannungsleitungen leben, nahelegt – allerdings mit einer nur sehr geringen Fallzahl.
Die EU-Kommission lässt zu diesem Thema verlautbaren, dass ein Zusammenhang "weder erklärt noch bekräftigt" werden könne.
Worüber Experten streiten
"Sie können nur nachweisen, ob etwas eine Wirkung hat – nicht, ob etwas keine Wirkung hat", sagt Metin Tolan.
"Letzte Sicherheit, ob die Strahlung Krebs verursacht, kann Ihnen keiner geben".
Wie auch andere Gegner der "Elektrosmog-Theorien" weist er auf "das seit 20 Jahren weltweit laufende Massenexperiment" hin: Es gibt heute mehr Handys als Menschen und die Geräte werden exzessiv genutzt.
"Müsste da nicht ein signifikanter Anstieg bestimmter Krankheiten zu verzeichnen sein, der nicht auf die Überalterung oder neuzeitliche Bewegungs- und Ernährungsgewohnheiten zurückzuführen ist?", fragt der Physiker.
"Wäre das Handy ein so gigantischer Krankheitsbeschleuniger, dann würde man das heute schon sehen."
Wilfried Kühling, Vorsitzender des Wissenschaftlichen Beirates des Bundes für Umwelt und Naturschutz (BUND) und dort im Bundesarbeitskreis Immissionsschutz, ist hingegen überzeugt, dass sich ein solcher Zusammenhang längst offenbart hat.
Es gebe eine Fülle von Untersuchungen, die auf Risiken und Gefahren hinweisen würden, deren "Kausalität lediglich im wissenschaftlichen Sinne nicht hinreichend erklärbar" sei.
"Der Mensch ist ein bioelektrisches Wesen", sagt Kühling.
Elektromagnetische Strahlung beeinflusse Hirnströme, zelluläre Prozesse und die Immunabwehr.
Die letzte Klarheit zwischen Ursache und Wirkung, wie sie für einen wissenschaftlichen Beweis vonnöten wäre, sei jedoch mit der "heute angewendeten Sichtweise" nicht zu erbringen.
"Da kommen mehrere Faktoren wie Strahlung, Lärm, Schadstoffe zusammen und haben gemeinsam möglicherweise krank machende Wirkung.
Was Verbraucher über Belastungswerte wissen müssen
Das Maß für die Energieaufnahme im Körper nennt sich "spezifische Absorptionsrate" – kurz SAR.
Das Bundesinstitut für Strahlenschutz (BfS) hat die SAR-Werte von mittlerweile über 2500 Smartphones, Tablets und anderen elektronischen Mobilgeräten erfasst.
Geordnet nach Modell, sind die einzelnen Werte im Internet unter
zu finden.
Auf Anraten der International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) sollte der SAR-Wert nicht mehr als zwei Watt pro Kilogramm betragen.
Nach Herstellerangaben unterschreiten alle heute im Handel befindlichen Handys diesen Wert.
Neuere Smartphones haben zudem den Vorteil, dass der Verbindungsaufbau über die Standards UMTS und LTE strahlungsärmer ist als bei dem älteren GSM-Standard.
Bei WLAN ist die Sendeleistung meist noch niedriger.
Wer auf eine geringere Strahlenbelastung achten möchte, dem empfiehlt das BfS, per Headset zu telefonieren und Smartphones, Tablets und Co. immer in dem vom Hersteller angegebenen Abstand zu halten.