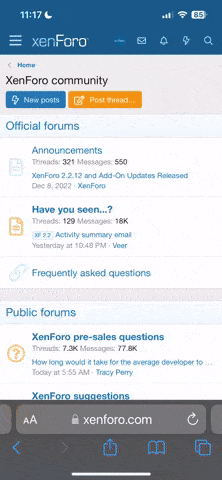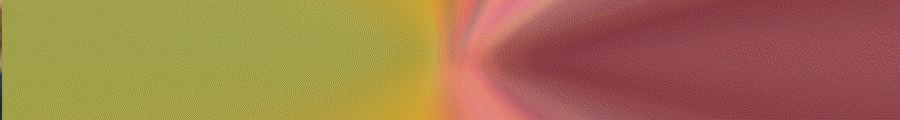collombo
MyBoerse.bz Pro Member
Konflikt zwischen Armenien und Aserbaidschan: Kriegsrecht ausgerufen - schwere Kämpfe in der Grenzregion !
Der blutige Konflikt zwischen Armenien und Aserbaidschan flammt wieder auf.
Die beiden Ex-Sowjetrepubliken haben jeweils das Kriegsrecht ausgerufen.
Es ist die schwerste Eskalation seit langem.
In der Unruheregion Berg-Karabach im Südkaukasus sind bei einer außergewöhnlichen Gewalteskalation zwischen den verfeindeten Nachbarn Armenien und Aserbaidschan mehrere Menschen verletzt und getötet worden.
Der armenische Regierungschef Nikol Paschinjan hat die Gefechte in der Unruheregion Berg-Karabach mit dem verfeindeten Nachbarn Aserbaidschan als Kriegserklärung gewertet.
"Das autoritäre Regime von Aliyev hat seine Feindseligkeiten wieder aufgenommen.
Es hat dem armenischen Volk den Krieg erklärt", sagte Paschinjan in einem Video, das er auf Facebook veröffentlichte.
Unter der Regierung von Ilham Aliyev habe Aserbaidschan mit schwerem Gerät Berg-Karabach angegriffen.
"Wir sind zu diesem Krieg bereit", sagte der armenische Regierungschef.
Am Sonntagmorgen hatte Armenien den Kriegszustand ausgerufen und kündigte eine Generalmobilmachung des ganzen Landes an.
Sonntagabend folgte dann die Ausrufung des Kriegsrechtes in Aserdaidschan.
"Das Kriegsrecht tritt um Mitternacht in Kraft", erklärte Präsidentensprecher Hikmet Hadschijew in der aserbaidschanischen Hauptstadt Baku.
Außerdem wurde nach seinen Angaben für mehrere große Städte, darunter Baku, sowie Gebiete in der Nähe der Frontlinie in Berg-Karabach eine nächtliche Ausgangssperre verhängt.
Tote und Verletzte auf beiden Seiten
Aserbaidschan hatte schon zuvor eine Militäroperation an der Demarkationslinie angekündigt sowie von einer Eroberung von sieben Dörfern gesprochen.
Die von Armenien kontrollierte Region gehört völkerrechtlich zum islamisch geprägten Aserbaidschan.
Es handelt sich um die schwerste Eskalation seit Jahrzehnten.
Nach offiziellen Angaben aus der Hauptstadt Stepanakert wurden etwa zehn Soldaten aus Berg-Karabach durch Beschuss getötet.
Auch Aserbaidschan teilte mit, dass es Tote und Verletzte in den eigenen Reihen gebe.
Zwischen den verfeindeten Ländern kam es nach Angaben beider Seiten am frühen Sonntagmorgen zu schweren Gefechten.
Stepanakert sei beschossen worden, die Menschen sollten sich in Sicherheit bringen, teilten die Behörden in Berg-Karabach mit.
Zahlreiche Häuser in Dörfern seien zerstört worden.
Auf Videos war zu sehen, wie Panzer durch die Orte fuhren und Rauchwolken über Stepanakert aufstiegen.
Beide Seiten geben sich Schuld an Gefechten
Nach Darstellung aus Baku und Eriwan dauerten die Kämpfe in der Region mit geschätzten 145.000 Einwohnern an.
Aserbaidschan eroberte nach Angaben des Verteidigungsministeriums sieben Dörfer im Konfliktgebiet.
Die Gebiete seien von der armenischen Besatzung befreit worden, sagte Verteidigungsminister Zakir Hasanov aserbaidschanischen Medien.
Die Behörden in Berg-Karabach betonten, dass dies eine "absolute Lüge" sei.
Sie hätten die Lage inzwischen unter Kontrolle.
Beide Seiten gaben sich die Schuld an den Gefechten. Armenien habe Hubschrauber und Kampfdrohnen abgeschossen.
Drei gegnerische Panzer seien getroffen worden.
Baku dementierte dies und betonte, es handele sich bei den Gefechten um eine Gegenoffensive.
Präsident Ilham Aliyev warf Armenien vor, den Verhandlungsprozess für eine friedliche Lösung des Konflikts zerstört zu haben.
Der aktuelle Zustand sei nicht mehr hinnehmbar.
"Das bedeutet, dass die Okkupation beendet werden muss."
Schutzmacht Russland gegen Schutzmacht Türkei
Aserbaidschan hatte in einem Krieg nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion die Kontrolle über das Gebiet verloren.
Berg-Karabach wird heute von christlichen Karabach-Armeniern bewohnt.
Seit 1994 gilt eine brüchige Waffenruhe.
Das völlig verarmte Armenien setzt auf Russland als Schutzmacht, die dort Tausende Soldaten und Waffen stationiert hat.
Erst am Wochenende hatte Eriwan ein gemeinsames Militärmanöver mit Moskau beendet.
Das öl- und gasreiche Aserbaidschan hat die Türkei als verbündeten Bruderstaat.
Baku hatte immer wieder angekündigt, sich die Region notfalls mit militärischer Gewalt zurückzuholen.
Das Land hatte in den vergangenen Jahren sein Militär massiv aufgerüstet.
Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan sicherte Aserbaidschan bereits seine Unterstützung zu.
Zuletzt flammte der Konflikt 2016 stark auf.
Dabei starben mehr als 120 Menschen.
Vor wenigen Monaten – im Juli – kam es an der Grenze zwischen den verfeindeten Ländern erneut zu schweren Gefechten; die Kämpfe lagen jedoch Hunderte Kilometer nördlich von Berg-Karabach.
Russland fordert Verhandlungen
Russische Politologen meinten, dass eine neue Eskalation in Berg-Karabach die Bemühungen in der Region um Jahrzehnte zurückwerfen könnte.
Es handele sich bei den Gefechten nicht um Scharmützel, die es in der Vergangenheit immer wieder gab, schrieb der russische Experte Dmitri Trenin vom Moskauer Carnegie Center.
"Hier kündigt sich ein Krieg an."
Staaten wie Russland und die USA müssten gemeinsam alles tun, um diese Entwicklung zu stoppen.
Der russische Außenminister Sergej Lawrow führte bereits wenige Stunden nach Bekanntwerden der Kämpfe intensive Gespräche, um die Konfliktparteien zur Einstellung des Feuers zu bewegen.
Beide Länder müssten an den Verhandlungstisch zurückkehren, hieß es.
Er telefonierte auch mit dem türkischen Außenminister Mevlüt Cavusoglu.
Deutschland und Frankreich forderten eine sofortige Einstellung der Kämpfe und eine Wiederaufnahme des Dialogs.
Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) zeigte sich alarmiert.
"Ich rufe beide Konfliktparteien dazu auf, sämtliche Kampfhandlungen und insbesondere den Beschuss von Dörfern und Städten umgehend einzustellen."
Die OSZE-Minsk-Gruppe stehe mit ihren drei Co-Vorsitzenden Frankreich, Russland und USA für Verhandlungen bereit.
Die OSZE ist die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa.
Internationale Gemeinschaft zeigt sich besorgt
EU-Ratschef Charles Michel zeigte sich in einem Tweet tief besorgt.
Der einzige Ausweg sei die unverzügliche Rückkehr zu Verhandlungen ohne Vorbedingungen.
Auch Europarat-Generalsekretärin Marija Pejcinovic Buric erklärte, die Konfliktstaaten sollten Verantwortung übernehmen und Zurückhaltung üben.
"Beim Beitritt zum Europarat haben sich beide Länder verpflichtet, den Konflikt mit friedlichen Mitteln zu lösen, und diese Verpflichtung ist strikt einzuhalten."
Papst Franziskus rief zu einer friedlichen Beilegung des Konflikts auf.
"Ich bete für den Frieden im Kaukasus", sagte er in seiner Angelus-Botschaft zu Gläubigen auf dem Petersplatz.
An die Konfliktparteien appellierte er, mit "Gesten des guten Willens und der Brüderlichkeit" dazu beizutragen, dass Probleme nicht mit Gewalt und Waffen, sondern durch Dialog und Verhandlungen gelöst werden.
Nach Darstellung aus Baku und Eriwan dauerten die Kämpfe an.
Der blutige Konflikt zwischen Armenien und Aserbaidschan flammt wieder auf.
Die beiden Ex-Sowjetrepubliken haben jeweils das Kriegsrecht ausgerufen.
Es ist die schwerste Eskalation seit langem.
In der Unruheregion Berg-Karabach im Südkaukasus sind bei einer außergewöhnlichen Gewalteskalation zwischen den verfeindeten Nachbarn Armenien und Aserbaidschan mehrere Menschen verletzt und getötet worden.
Der armenische Regierungschef Nikol Paschinjan hat die Gefechte in der Unruheregion Berg-Karabach mit dem verfeindeten Nachbarn Aserbaidschan als Kriegserklärung gewertet.
"Das autoritäre Regime von Aliyev hat seine Feindseligkeiten wieder aufgenommen.
Es hat dem armenischen Volk den Krieg erklärt", sagte Paschinjan in einem Video, das er auf Facebook veröffentlichte.
Unter der Regierung von Ilham Aliyev habe Aserbaidschan mit schwerem Gerät Berg-Karabach angegriffen.
"Wir sind zu diesem Krieg bereit", sagte der armenische Regierungschef.
Am Sonntagmorgen hatte Armenien den Kriegszustand ausgerufen und kündigte eine Generalmobilmachung des ganzen Landes an.
Sonntagabend folgte dann die Ausrufung des Kriegsrechtes in Aserdaidschan.
"Das Kriegsrecht tritt um Mitternacht in Kraft", erklärte Präsidentensprecher Hikmet Hadschijew in der aserbaidschanischen Hauptstadt Baku.
Außerdem wurde nach seinen Angaben für mehrere große Städte, darunter Baku, sowie Gebiete in der Nähe der Frontlinie in Berg-Karabach eine nächtliche Ausgangssperre verhängt.
Tote und Verletzte auf beiden Seiten
Aserbaidschan hatte schon zuvor eine Militäroperation an der Demarkationslinie angekündigt sowie von einer Eroberung von sieben Dörfern gesprochen.
Die von Armenien kontrollierte Region gehört völkerrechtlich zum islamisch geprägten Aserbaidschan.
Es handelt sich um die schwerste Eskalation seit Jahrzehnten.
Nach offiziellen Angaben aus der Hauptstadt Stepanakert wurden etwa zehn Soldaten aus Berg-Karabach durch Beschuss getötet.
Auch Aserbaidschan teilte mit, dass es Tote und Verletzte in den eigenen Reihen gebe.
Zwischen den verfeindeten Ländern kam es nach Angaben beider Seiten am frühen Sonntagmorgen zu schweren Gefechten.
Stepanakert sei beschossen worden, die Menschen sollten sich in Sicherheit bringen, teilten die Behörden in Berg-Karabach mit.
Zahlreiche Häuser in Dörfern seien zerstört worden.
Auf Videos war zu sehen, wie Panzer durch die Orte fuhren und Rauchwolken über Stepanakert aufstiegen.
Beide Seiten geben sich Schuld an Gefechten
Nach Darstellung aus Baku und Eriwan dauerten die Kämpfe in der Region mit geschätzten 145.000 Einwohnern an.
Aserbaidschan eroberte nach Angaben des Verteidigungsministeriums sieben Dörfer im Konfliktgebiet.
Die Gebiete seien von der armenischen Besatzung befreit worden, sagte Verteidigungsminister Zakir Hasanov aserbaidschanischen Medien.
Die Behörden in Berg-Karabach betonten, dass dies eine "absolute Lüge" sei.
Sie hätten die Lage inzwischen unter Kontrolle.
Beide Seiten gaben sich die Schuld an den Gefechten. Armenien habe Hubschrauber und Kampfdrohnen abgeschossen.
Drei gegnerische Panzer seien getroffen worden.
Baku dementierte dies und betonte, es handele sich bei den Gefechten um eine Gegenoffensive.
Präsident Ilham Aliyev warf Armenien vor, den Verhandlungsprozess für eine friedliche Lösung des Konflikts zerstört zu haben.
Der aktuelle Zustand sei nicht mehr hinnehmbar.
"Das bedeutet, dass die Okkupation beendet werden muss."
Schutzmacht Russland gegen Schutzmacht Türkei
Aserbaidschan hatte in einem Krieg nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion die Kontrolle über das Gebiet verloren.
Berg-Karabach wird heute von christlichen Karabach-Armeniern bewohnt.
Seit 1994 gilt eine brüchige Waffenruhe.
Das völlig verarmte Armenien setzt auf Russland als Schutzmacht, die dort Tausende Soldaten und Waffen stationiert hat.
Erst am Wochenende hatte Eriwan ein gemeinsames Militärmanöver mit Moskau beendet.
Das öl- und gasreiche Aserbaidschan hat die Türkei als verbündeten Bruderstaat.
Baku hatte immer wieder angekündigt, sich die Region notfalls mit militärischer Gewalt zurückzuholen.
Das Land hatte in den vergangenen Jahren sein Militär massiv aufgerüstet.
Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan sicherte Aserbaidschan bereits seine Unterstützung zu.
Zuletzt flammte der Konflikt 2016 stark auf.
Dabei starben mehr als 120 Menschen.
Vor wenigen Monaten – im Juli – kam es an der Grenze zwischen den verfeindeten Ländern erneut zu schweren Gefechten; die Kämpfe lagen jedoch Hunderte Kilometer nördlich von Berg-Karabach.
Russland fordert Verhandlungen
Russische Politologen meinten, dass eine neue Eskalation in Berg-Karabach die Bemühungen in der Region um Jahrzehnte zurückwerfen könnte.
Es handele sich bei den Gefechten nicht um Scharmützel, die es in der Vergangenheit immer wieder gab, schrieb der russische Experte Dmitri Trenin vom Moskauer Carnegie Center.
"Hier kündigt sich ein Krieg an."
Staaten wie Russland und die USA müssten gemeinsam alles tun, um diese Entwicklung zu stoppen.
Der russische Außenminister Sergej Lawrow führte bereits wenige Stunden nach Bekanntwerden der Kämpfe intensive Gespräche, um die Konfliktparteien zur Einstellung des Feuers zu bewegen.
Beide Länder müssten an den Verhandlungstisch zurückkehren, hieß es.
Er telefonierte auch mit dem türkischen Außenminister Mevlüt Cavusoglu.
Deutschland und Frankreich forderten eine sofortige Einstellung der Kämpfe und eine Wiederaufnahme des Dialogs.
Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) zeigte sich alarmiert.
"Ich rufe beide Konfliktparteien dazu auf, sämtliche Kampfhandlungen und insbesondere den Beschuss von Dörfern und Städten umgehend einzustellen."
Die OSZE-Minsk-Gruppe stehe mit ihren drei Co-Vorsitzenden Frankreich, Russland und USA für Verhandlungen bereit.
Die OSZE ist die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa.
Internationale Gemeinschaft zeigt sich besorgt
EU-Ratschef Charles Michel zeigte sich in einem Tweet tief besorgt.
Der einzige Ausweg sei die unverzügliche Rückkehr zu Verhandlungen ohne Vorbedingungen.
Auch Europarat-Generalsekretärin Marija Pejcinovic Buric erklärte, die Konfliktstaaten sollten Verantwortung übernehmen und Zurückhaltung üben.
"Beim Beitritt zum Europarat haben sich beide Länder verpflichtet, den Konflikt mit friedlichen Mitteln zu lösen, und diese Verpflichtung ist strikt einzuhalten."
Papst Franziskus rief zu einer friedlichen Beilegung des Konflikts auf.
"Ich bete für den Frieden im Kaukasus", sagte er in seiner Angelus-Botschaft zu Gläubigen auf dem Petersplatz.
An die Konfliktparteien appellierte er, mit "Gesten des guten Willens und der Brüderlichkeit" dazu beizutragen, dass Probleme nicht mit Gewalt und Waffen, sondern durch Dialog und Verhandlungen gelöst werden.
Nach Darstellung aus Baku und Eriwan dauerten die Kämpfe an.