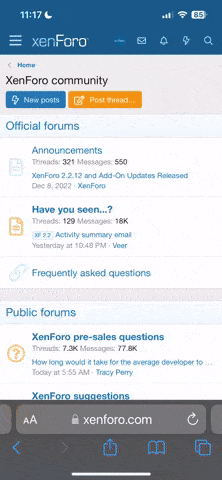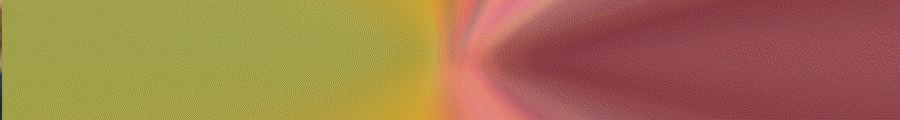collombo
MyBoerse.bz Pro Member
Mutante B.1.1.7: Anzeichen für höhere Sterblichkeit !
Das britische Beratungsgremium „Nervtag“ schlägt Alarm wegen neuer Studienergebnisse über die Corona-Mutante B.1.1.7.
Doch die Unsicherheit über die Häufigkeit schwerer Krankheitsverläufe bleibt groß
Die ansteckendere Coronavirus-Variante B.1.1.7 ist wahrscheinlich mit einem erhöhten Risiko für einen schweren und tödlichen Verlauf verbunden.
Das ist zumindest die Einschätzung des wissenschaftlichen Beratungsgremiums „Nervtag“, das Anfang dieser Woche eine aktualisierte Auswertung von einem Dutzend Beobachtungs- und Modellstudien in Großbritannien vorgelegt hat.
Wie viel gefährlicher die sich weltweit ausbreitende Variante für Infizierte genau ist, bleibt unklar.
Viele der seit Ende vergangenen Jahres gestarteten Untersuchungen berücksichtigen immer noch zu wenige Patienten, um einen statistisch abgesicherten Vergleich der Infektionen mit unterschiedlichen Virenvarianten vornehmen zu können.
Zwei Drittel der Untersuchungen erkennen in den Daten allerdings schon einen deutlichen Anstieg des Erkrankungsrisikos: Zwischen rund 30 und 70 Prozent schwanken die Schätzungen.
Allerdings verwenden die Studien oft die gleichen Datensätze für ihre Analysen.
Ein Drittel der klinischen Studien kann noch keinerlei erhöhtes Sterbe- oder Hospitalisierungsrisiko feststellen.
Das deckt sich zumindest mit den Ergebnissen einer Veröffentlichung in der Medizinzeitschrift „Lancet Child & Adolescent Health“, in der Kinderärzte des University College London sechzig aktuelle klinische Covid-19-Verläufe bei Kindern zwischen einem und 13 Jahren mit zwanzig Kinderinfektionen während der ersten Welle im Frühjahr vorigen Jahres verglichen haben.
„Der klinische Verlauf unterscheidet sich mit der Variante B.1.1.7 unwesentlich“, resümierten die Ärzte.
Mehr schwere Verläufe seien nicht zu beobachten gewesen.
Die seit der starken Ausbreitung der inzwischen landesweit dominanten B.1.1.7-Variante insgesamt häufiger beobachteten Infektionen bei Kindern führen die Ärzte darauf zurück, dass im britischen Lockdown anfangs noch Schulen und Kitas geöffnet waren.
Das Infektionsgeschehen habe sich dadurch stärker zu den jüngeren Altersgruppen hin verlagert.
Studien fehlen
Die Kinderärzte haben allerdings den Anteil der mit der neuen Variante infizierten jungen Patienten in der zweiten Welle nicht explizit ermittelt.
In dem jüngsten Nervtag-Bericht fehlen auch entscheidende Informationen, unter anderem über die Virenbelastung der Patienten und mögliche Erklärungen für die höhere Sterblichkeit.
In den vergangenen Tagen waren in den sozialen Medien vereinzelt wissenschaftliche Hinweise aus Laboruntersuchungen geliefert worden, die auf einen möglichen Mechanismus für die schweren Verläufe und das erhöhte Sterberisiko hindeuten.
Demnach vermehrt sich die B.1.1.7-Variante im Vergleich zum Originalvirus – und auch verglichen mit der „südafrikanischen“ Variante B.1.351 – kurz nach der Ansteckung sehr viel schneller.
Die Viruslast könnte also deutlich rascher wachsen und damit insbesondere das Immunsystem bei bestimmten Menschen rasch überfordern – was sich in einer Entgleisung der Immunantwort ausdrücken könnte.
Allerdings handelt es sich bei dieser Annahme bislang noch lediglich um Spekulationen von Fachleuten im Internet.
Nachprüfbare Studien gibt es dazu bislang nicht.
Schon die mittlerweile experimentell abgesicherte erhöhte Übertragungsrate der B.1.1.7-Variante ist epidemiologisch kritisch, solange die Impfquoten in den gefährdeten Teilen der Bevölkerung niedrig sind.
Das europäische Seuchenzentrum ECDC hat sich am Montag in einer aktualisierten Risikoabschätzung den von den britischen Regierungsbehörden verschärften Warnungen angeschlossen: Die beschleunigte Ausbreitung von B.1.1.7 habe in einigen Ländern schon „zu erhöhten Fallzahlen, überlasteten Gesundheitssystemen und einer größeren Übersterblichkeit“ geführt.
Das britische Beratungsgremium „Nervtag“ schlägt Alarm wegen neuer Studienergebnisse über die Corona-Mutante B.1.1.7.
Doch die Unsicherheit über die Häufigkeit schwerer Krankheitsverläufe bleibt groß
Die ansteckendere Coronavirus-Variante B.1.1.7 ist wahrscheinlich mit einem erhöhten Risiko für einen schweren und tödlichen Verlauf verbunden.
Das ist zumindest die Einschätzung des wissenschaftlichen Beratungsgremiums „Nervtag“, das Anfang dieser Woche eine aktualisierte Auswertung von einem Dutzend Beobachtungs- und Modellstudien in Großbritannien vorgelegt hat.
Wie viel gefährlicher die sich weltweit ausbreitende Variante für Infizierte genau ist, bleibt unklar.
Viele der seit Ende vergangenen Jahres gestarteten Untersuchungen berücksichtigen immer noch zu wenige Patienten, um einen statistisch abgesicherten Vergleich der Infektionen mit unterschiedlichen Virenvarianten vornehmen zu können.
Zwei Drittel der Untersuchungen erkennen in den Daten allerdings schon einen deutlichen Anstieg des Erkrankungsrisikos: Zwischen rund 30 und 70 Prozent schwanken die Schätzungen.
Allerdings verwenden die Studien oft die gleichen Datensätze für ihre Analysen.
Ein Drittel der klinischen Studien kann noch keinerlei erhöhtes Sterbe- oder Hospitalisierungsrisiko feststellen.
Das deckt sich zumindest mit den Ergebnissen einer Veröffentlichung in der Medizinzeitschrift „Lancet Child & Adolescent Health“, in der Kinderärzte des University College London sechzig aktuelle klinische Covid-19-Verläufe bei Kindern zwischen einem und 13 Jahren mit zwanzig Kinderinfektionen während der ersten Welle im Frühjahr vorigen Jahres verglichen haben.
„Der klinische Verlauf unterscheidet sich mit der Variante B.1.1.7 unwesentlich“, resümierten die Ärzte.
Mehr schwere Verläufe seien nicht zu beobachten gewesen.
Die seit der starken Ausbreitung der inzwischen landesweit dominanten B.1.1.7-Variante insgesamt häufiger beobachteten Infektionen bei Kindern führen die Ärzte darauf zurück, dass im britischen Lockdown anfangs noch Schulen und Kitas geöffnet waren.
Das Infektionsgeschehen habe sich dadurch stärker zu den jüngeren Altersgruppen hin verlagert.
Studien fehlen
Die Kinderärzte haben allerdings den Anteil der mit der neuen Variante infizierten jungen Patienten in der zweiten Welle nicht explizit ermittelt.
In dem jüngsten Nervtag-Bericht fehlen auch entscheidende Informationen, unter anderem über die Virenbelastung der Patienten und mögliche Erklärungen für die höhere Sterblichkeit.
In den vergangenen Tagen waren in den sozialen Medien vereinzelt wissenschaftliche Hinweise aus Laboruntersuchungen geliefert worden, die auf einen möglichen Mechanismus für die schweren Verläufe und das erhöhte Sterberisiko hindeuten.
Demnach vermehrt sich die B.1.1.7-Variante im Vergleich zum Originalvirus – und auch verglichen mit der „südafrikanischen“ Variante B.1.351 – kurz nach der Ansteckung sehr viel schneller.
Die Viruslast könnte also deutlich rascher wachsen und damit insbesondere das Immunsystem bei bestimmten Menschen rasch überfordern – was sich in einer Entgleisung der Immunantwort ausdrücken könnte.
Allerdings handelt es sich bei dieser Annahme bislang noch lediglich um Spekulationen von Fachleuten im Internet.
Nachprüfbare Studien gibt es dazu bislang nicht.
Schon die mittlerweile experimentell abgesicherte erhöhte Übertragungsrate der B.1.1.7-Variante ist epidemiologisch kritisch, solange die Impfquoten in den gefährdeten Teilen der Bevölkerung niedrig sind.
Das europäische Seuchenzentrum ECDC hat sich am Montag in einer aktualisierten Risikoabschätzung den von den britischen Regierungsbehörden verschärften Warnungen angeschlossen: Die beschleunigte Ausbreitung von B.1.1.7 habe in einigen Ländern schon „zu erhöhten Fallzahlen, überlasteten Gesundheitssystemen und einer größeren Übersterblichkeit“ geführt.