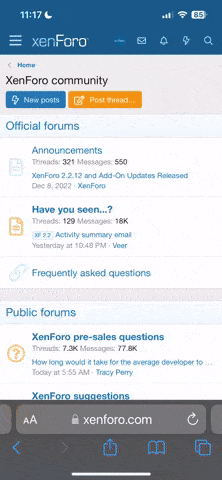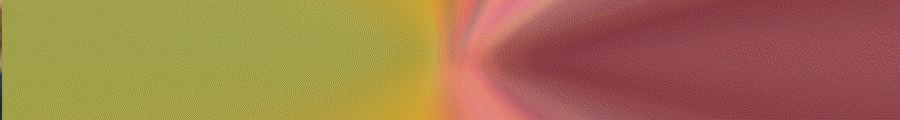collombo
MyBoerse.bz Pro Member
Virologe Kekulé bei "Markus Lanz": "Astrazeneca ist ein Impfstoff zweiter Klasse" !
Virologe Kekulé fordert bei Lanz eine radikal neue Impfstrategie: Erst mal eine Dosis für alle Menschen Ü70 – "weil wir damit das Sterben beenden".
Astrazeneca sei zwar ein "Impfstoff zweiter Klasse".
Das sei aber kein Grund fürs Verweigern.
Virologe Alexander Kekulé drängt die Bundesregierung zu einer Kehrtwende in der Corona-Impfstrategie.
In Israel habe der Impfstoff von Biontech/Pfizer ersten Studienergebnissen zufolge bereits nach der ersten Dosis einen etwa 85-prozentigen Schutz gezeigt.
Den müsse man sich auch hierzulande endlich zunutze machen, sagte Kekulé am Dienstagabend bei "Markus Lanz".
Er forderte, den gesamten Bestand des hochwirksamen RNA-Wirkstoffs "zusammenzukratzen" und alle Menschen über 70 Jahre "radikal konsequent" erst mal mit nur einer Dosis zu immunisieren – "weil wir so das Sterben beenden", sagte der Virologe mit Blick auf die in Israel stark gefallenen Todeszahlen unter alten Menschen.
"Diese Wurst vor der Nase mit der Herdenimmunität, von dieser Vorstellung müssen wir uns lösen", sagte der Direktor des Instituts für Medizinische Mikrobiologie an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg.
Die Menschheit müsse lernen, mit dem Virus und dessen immer neuen Varianten zu leben.
Für verfehlt hält der Experte zudem die deutsche Zielmarke einer Inzidenz von 35, ab der weitergehende Lockerungen wieder möglich sein sollen.
Dieser Wert ist ihm zufolge nur mit weiteren Verschärfungen des Lockdowns zu erreichen.
Die Folge wäre ein "zu hoher psychischer Kollateralschaden".
Kekulé fordert mehr Schnelltests
Kekulé plädierte stattdessen dafür, in Schulen oder bei körpernahen Dienstleistungen stärker auf Schnelltests zu setzen.
Dann könne die aktuelle Sieben-Tage-Inzidenz von 60 stabil ohne zu starke Einschränkungen gehalten werden.
Der Virologe empfahl zudem dringend, den Impfstoff von Astrazeneca zu nutzen.
"Die Wahrheit ist: Astrazeneca ist ein Impfstoff zweiter Klasse", räumte er ein.
"Aber besser zweiter Klasse mit der Bahn fahren als zu Fuß gehen."
Kekulé verglich Menschen, die in der jetzigen Lage auf dem RNA-Impfstoff bestehen mit Reisenden, die lieber zu Hause bleiben, wenn sie nicht First Class oder Business Class fliegen können.
Kekulé meldete sich in der Runde immer wieder zu Wort und positionierte sich sowohl als politischer Insider als auch als Außenseiter in der Forschungsgemeinschaft, der gegen die Mehrheitsmeinung argumentiert.
Der anerkannte Virologe Christian Drosten hat ihm in der Vergangenheit unqualifizierte Stimmungsmache vorgeworfen.
Kekulé kritisierte bei Lanz mehrmals das Robert-Koch-Institut (RKI) und machte unter anderem auch diese Bundesoberbehörde für das planlose Vorgehen der Politik in der Coronakrise verantwortlich.
"Wenn das Robert-Koch-Institut frühzeitig eine wissenschaftlich begründete, gute Strategie vorgelegt hätte, dann hätte keines der Länder und auch keiner der Ministerpräsidenten ernsthaft widersprochen", sagte er.
Stattdessen aber habe von Anfang an ein überzeugendes Konzept gefehlt.
De Maizière will mehr Macht für den Bund
Ex-Bundesinnenminister Thomas de Maizière übte ebenfalls scharfe Kritik am Krisenmanagement und der Kommunikation von Bund und Ländern.
"Ich würde mir in dieser schwierigen Phase wünschen, dass sich alle ein bisschen mehr zusammenreißen", mahnte der CDU-Politiker.
"Bei uns quatschen alle mit."
Alle drei Tage gebe es eine neue Strategiedebatte und jedes Land verfolge eigene Pläne, etwa bei den Schulöffnungen.
"Alle werden doch verrückt gemacht", kritisierte de Maizière.
"Wie sollen da normale Menschen noch irgendwie Vertrauen gewinnen?"
Der ehemalige Innenminister forderte deshalb von der nächsten Bundesregierung eine "große Staatsreform", um das Land künftig besser auf derartige Notlagen vorzubereiten.
Das bedeute auch mehr Macht für den Bund.
"In der Krise muss es andere Zuständigkeiten geben", unterstrich er.
"Corona ist die Chance zu überlegen: Wie müssen wir unseren Staat besser organisieren, damit er in der Krise handlungsfähig ist?"
Kurzer Faktencheck zum Schluss: Das RKI hält daran fest, dass für eine vollständige Immunisierung mit den Präparaten von Biontech und Astrazeneca zwei Impfstoffdosen notwendig sind.
Die Ständige Impfkommission empfehle einen Abstand von drei bis zwölf Wochen, je nach Hersteller, heißt es im Covid-19-Online-Ratgeber der Behörde.
Dort wird aber auch festgehalten: "Sollte der empfohlene maximale Abstand zwischen der ersten und zweiten Impfstoffdosis überschritten worden sein, kann die Impfserie dennoch fortgesetzt werden und muss nicht neu begonnen werden."
Virologe Christian Drosten hat vor einigen Tagen mit Blick auf Israel der ersten Impfdosis von Biontech ebenfalls einen "erstaunlichen Schutzeffekt" attestiert.
"Es ist nur die erste Dosis, die man anscheinend braucht, um wieder zu einem deutlichen Absenken der Viruslast zu kommen, so knapp drei Wochen später", sagte der Direktor des Instituts für Virologie an der Berliner Charité im NDR-Corona-Podcast.
"Das ist ein Bereich, da ist nach unserer Einschätzung wirklich die Infektiosität zu Ende."
Drosten warnte allerdings davor, ähnlich schnelle Erfolge auch für Deutschland zu erwarten.
"Bei uns würden sich diese Dinge aber wohl auf längeren Zeitskalen bewegen, weil wir einfach ein viel komplexeres Land sind.
Wir schaffen das eben nicht in so kurzer Zeit, mal eben in der Gesamtbevölkerung über 16 Jahren auf Durchimpfungsraten von 45 Prozent zu kommen.
Bei uns wären diese Zeiträume deutlich länger.
Da muss man sich gegen wappnen."
Quellen:
Virologe Kekulé fordert bei Lanz eine radikal neue Impfstrategie: Erst mal eine Dosis für alle Menschen Ü70 – "weil wir damit das Sterben beenden".
Astrazeneca sei zwar ein "Impfstoff zweiter Klasse".
Das sei aber kein Grund fürs Verweigern.
Virologe Alexander Kekulé drängt die Bundesregierung zu einer Kehrtwende in der Corona-Impfstrategie.
In Israel habe der Impfstoff von Biontech/Pfizer ersten Studienergebnissen zufolge bereits nach der ersten Dosis einen etwa 85-prozentigen Schutz gezeigt.
Den müsse man sich auch hierzulande endlich zunutze machen, sagte Kekulé am Dienstagabend bei "Markus Lanz".
Er forderte, den gesamten Bestand des hochwirksamen RNA-Wirkstoffs "zusammenzukratzen" und alle Menschen über 70 Jahre "radikal konsequent" erst mal mit nur einer Dosis zu immunisieren – "weil wir so das Sterben beenden", sagte der Virologe mit Blick auf die in Israel stark gefallenen Todeszahlen unter alten Menschen.
"Diese Wurst vor der Nase mit der Herdenimmunität, von dieser Vorstellung müssen wir uns lösen", sagte der Direktor des Instituts für Medizinische Mikrobiologie an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg.
Die Menschheit müsse lernen, mit dem Virus und dessen immer neuen Varianten zu leben.
Für verfehlt hält der Experte zudem die deutsche Zielmarke einer Inzidenz von 35, ab der weitergehende Lockerungen wieder möglich sein sollen.
Dieser Wert ist ihm zufolge nur mit weiteren Verschärfungen des Lockdowns zu erreichen.
Die Folge wäre ein "zu hoher psychischer Kollateralschaden".
Kekulé fordert mehr Schnelltests
Kekulé plädierte stattdessen dafür, in Schulen oder bei körpernahen Dienstleistungen stärker auf Schnelltests zu setzen.
Dann könne die aktuelle Sieben-Tage-Inzidenz von 60 stabil ohne zu starke Einschränkungen gehalten werden.
Der Virologe empfahl zudem dringend, den Impfstoff von Astrazeneca zu nutzen.
"Die Wahrheit ist: Astrazeneca ist ein Impfstoff zweiter Klasse", räumte er ein.
"Aber besser zweiter Klasse mit der Bahn fahren als zu Fuß gehen."
Kekulé verglich Menschen, die in der jetzigen Lage auf dem RNA-Impfstoff bestehen mit Reisenden, die lieber zu Hause bleiben, wenn sie nicht First Class oder Business Class fliegen können.
Kekulé meldete sich in der Runde immer wieder zu Wort und positionierte sich sowohl als politischer Insider als auch als Außenseiter in der Forschungsgemeinschaft, der gegen die Mehrheitsmeinung argumentiert.
Der anerkannte Virologe Christian Drosten hat ihm in der Vergangenheit unqualifizierte Stimmungsmache vorgeworfen.
Kekulé kritisierte bei Lanz mehrmals das Robert-Koch-Institut (RKI) und machte unter anderem auch diese Bundesoberbehörde für das planlose Vorgehen der Politik in der Coronakrise verantwortlich.
"Wenn das Robert-Koch-Institut frühzeitig eine wissenschaftlich begründete, gute Strategie vorgelegt hätte, dann hätte keines der Länder und auch keiner der Ministerpräsidenten ernsthaft widersprochen", sagte er.
Stattdessen aber habe von Anfang an ein überzeugendes Konzept gefehlt.
De Maizière will mehr Macht für den Bund
Ex-Bundesinnenminister Thomas de Maizière übte ebenfalls scharfe Kritik am Krisenmanagement und der Kommunikation von Bund und Ländern.
"Ich würde mir in dieser schwierigen Phase wünschen, dass sich alle ein bisschen mehr zusammenreißen", mahnte der CDU-Politiker.
"Bei uns quatschen alle mit."
Alle drei Tage gebe es eine neue Strategiedebatte und jedes Land verfolge eigene Pläne, etwa bei den Schulöffnungen.
"Alle werden doch verrückt gemacht", kritisierte de Maizière.
"Wie sollen da normale Menschen noch irgendwie Vertrauen gewinnen?"
Der ehemalige Innenminister forderte deshalb von der nächsten Bundesregierung eine "große Staatsreform", um das Land künftig besser auf derartige Notlagen vorzubereiten.
Das bedeute auch mehr Macht für den Bund.
"In der Krise muss es andere Zuständigkeiten geben", unterstrich er.
"Corona ist die Chance zu überlegen: Wie müssen wir unseren Staat besser organisieren, damit er in der Krise handlungsfähig ist?"
Kurzer Faktencheck zum Schluss: Das RKI hält daran fest, dass für eine vollständige Immunisierung mit den Präparaten von Biontech und Astrazeneca zwei Impfstoffdosen notwendig sind.
Die Ständige Impfkommission empfehle einen Abstand von drei bis zwölf Wochen, je nach Hersteller, heißt es im Covid-19-Online-Ratgeber der Behörde.
Dort wird aber auch festgehalten: "Sollte der empfohlene maximale Abstand zwischen der ersten und zweiten Impfstoffdosis überschritten worden sein, kann die Impfserie dennoch fortgesetzt werden und muss nicht neu begonnen werden."
Virologe Christian Drosten hat vor einigen Tagen mit Blick auf Israel der ersten Impfdosis von Biontech ebenfalls einen "erstaunlichen Schutzeffekt" attestiert.
"Es ist nur die erste Dosis, die man anscheinend braucht, um wieder zu einem deutlichen Absenken der Viruslast zu kommen, so knapp drei Wochen später", sagte der Direktor des Instituts für Virologie an der Berliner Charité im NDR-Corona-Podcast.
"Das ist ein Bereich, da ist nach unserer Einschätzung wirklich die Infektiosität zu Ende."
Drosten warnte allerdings davor, ähnlich schnelle Erfolge auch für Deutschland zu erwarten.
"Bei uns würden sich diese Dinge aber wohl auf längeren Zeitskalen bewegen, weil wir einfach ein viel komplexeres Land sind.
Wir schaffen das eben nicht in so kurzer Zeit, mal eben in der Gesamtbevölkerung über 16 Jahren auf Durchimpfungsraten von 45 Prozent zu kommen.
Bei uns wären diese Zeiträume deutlich länger.
Da muss man sich gegen wappnen."
Quellen: