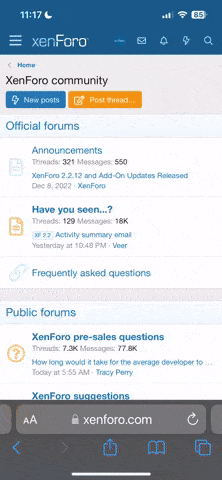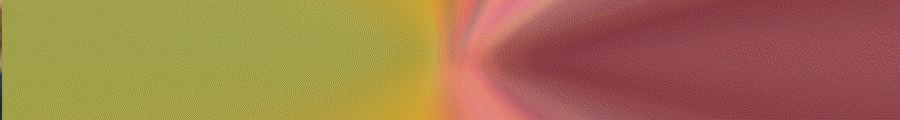collombo
MyBoerse.bz Pro Member
Nach Plagiatsvorwürfen: Giffey verzichtet auf ihren Doktortitel !
Familienministerin Giffey verzichtet freiwillig darauf, ihren Doktortitel weiterhin zu führen.
In der vergangenen Woche keimten die Plagiatsvorwürfe gegen sie wieder auf.
Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) gibt freiwillig ihren Doktortitel ab.
Das teilte die stellvertretende Vorsitzende des Berliner Landesverbands, Iris Spranger, am Freitag auf Anfrage mit.
Zuvor hatte die "Berliner Morgenpost" darüber berichtet.
"Ich habe große Hochachtung vor Franziska Giffey, weil sie Schaden von ihrer Familie und ihrer Partei abwenden möchte", sagte Spranger.
Zuvor hatte es mehrfach Plagiatsvorwürfe gegen Giffey gegeben.
„Um weiteren Schaden von meiner Familie, meiner politischen Arbeit und meiner Partei abzuwenden, erkläre ich, den mir am 16. Februar 2010 von der Freien Universität Berlin mit der Gesamtnote „magna cum laude“ verliehenen Titel Dr. rer. pol. ab sofort und auch zukünftig nicht mehr zu führen“, zitierte die Berliner Morgenpost Giffey.
Giffey: Identität nicht abhängig vom Titel
Sie teilte am Freitag außerdem mit: "Ich bin nicht gewillt, meine Dissertation und das damit verbundene nun neu aufgerollte Verfahren weiter zum Gegenstand politischer Auseinandersetzungen zu machen."
Und weiter: "Wer ich bin und was ich kann, ist nicht abhängig von diesem Titel.
Was mich als Mensch ausmacht, liegt nicht in diesem akademischen Grad begründet."
Sie habe gegenüber der Universität erneut bekräftigt, dass sie ihre Doktorarbeit "nach bestem Wissen und Gewissen verfasst" habe, schrieb Giffey.
Das Gremium zur Überprüfung der Dissertation sei 2019 zu dem Schluss gekommen, dass "trotz der festgestellten Mängel" nicht grundsätzlich in Frage gestellt werden könne, dass es sich um eine eigenständige wissenschaftliche Leistung handele, die Universität habe ihr mitgeteilt, dass eine Entziehung des Doktorgrades nicht als verhältnismäßig bewertet werde.
"Ich habe auf diesen Entschluss vertraut.
Über ein Jahr später kommt sie zu einer anderen Einschätzung", hieß es in Giffeys Statement.
Giffey kandidiert weiterhin für Berliner SPD-Vorsitz
Im Herbst 2019 prüfte die Universität die Vorwürfe gegen Giffey schon einmal, entschied sich jedoch gegen eine Aberkennung.
Lediglich eine Rüge wurde ausgesprochen.
In der vergangenen Woche hieß es dann, man werde die Arbeit erneut prüfen.
Dem kommt die Familienministerin nun zuvor.
Trotz des Ärgers um ihren Doktortitel will die 42-Jährige weiterhin für den Berliner SPD-Vorsitz kandidieren.
"Ich kandidiere beim digitalen Parteitag am 27. November für den Landesvorsitz der Berliner SPD und freue mich darauf, im nächsten Jahr gemeinsam mit den Berliner Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten einen engagierten Wahlkampf zu führen", so Giffey.
Der Landesverband bestätigte dies: "Wir haben das heute Morgen auch noch einmal im geschäftsführenden Landesvorstand besprochen und sie unserer Solidarität versichert, und wir gehen fest davon aus, dass sie auch unsere Spitzenkandidatin wird", sagte der stellvertretende Landesvorsitzende und Innensenator Andreas Geisel.
Familienministerin Giffey verzichtet freiwillig darauf, ihren Doktortitel weiterhin zu führen.
In der vergangenen Woche keimten die Plagiatsvorwürfe gegen sie wieder auf.
Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) gibt freiwillig ihren Doktortitel ab.
Das teilte die stellvertretende Vorsitzende des Berliner Landesverbands, Iris Spranger, am Freitag auf Anfrage mit.
Zuvor hatte die "Berliner Morgenpost" darüber berichtet.
"Ich habe große Hochachtung vor Franziska Giffey, weil sie Schaden von ihrer Familie und ihrer Partei abwenden möchte", sagte Spranger.
Zuvor hatte es mehrfach Plagiatsvorwürfe gegen Giffey gegeben.
„Um weiteren Schaden von meiner Familie, meiner politischen Arbeit und meiner Partei abzuwenden, erkläre ich, den mir am 16. Februar 2010 von der Freien Universität Berlin mit der Gesamtnote „magna cum laude“ verliehenen Titel Dr. rer. pol. ab sofort und auch zukünftig nicht mehr zu führen“, zitierte die Berliner Morgenpost Giffey.
Giffey: Identität nicht abhängig vom Titel
Sie teilte am Freitag außerdem mit: "Ich bin nicht gewillt, meine Dissertation und das damit verbundene nun neu aufgerollte Verfahren weiter zum Gegenstand politischer Auseinandersetzungen zu machen."
Und weiter: "Wer ich bin und was ich kann, ist nicht abhängig von diesem Titel.
Was mich als Mensch ausmacht, liegt nicht in diesem akademischen Grad begründet."
Sie habe gegenüber der Universität erneut bekräftigt, dass sie ihre Doktorarbeit "nach bestem Wissen und Gewissen verfasst" habe, schrieb Giffey.
Das Gremium zur Überprüfung der Dissertation sei 2019 zu dem Schluss gekommen, dass "trotz der festgestellten Mängel" nicht grundsätzlich in Frage gestellt werden könne, dass es sich um eine eigenständige wissenschaftliche Leistung handele, die Universität habe ihr mitgeteilt, dass eine Entziehung des Doktorgrades nicht als verhältnismäßig bewertet werde.
"Ich habe auf diesen Entschluss vertraut.
Über ein Jahr später kommt sie zu einer anderen Einschätzung", hieß es in Giffeys Statement.
Giffey kandidiert weiterhin für Berliner SPD-Vorsitz
Im Herbst 2019 prüfte die Universität die Vorwürfe gegen Giffey schon einmal, entschied sich jedoch gegen eine Aberkennung.
Lediglich eine Rüge wurde ausgesprochen.
In der vergangenen Woche hieß es dann, man werde die Arbeit erneut prüfen.
Dem kommt die Familienministerin nun zuvor.
Trotz des Ärgers um ihren Doktortitel will die 42-Jährige weiterhin für den Berliner SPD-Vorsitz kandidieren.
"Ich kandidiere beim digitalen Parteitag am 27. November für den Landesvorsitz der Berliner SPD und freue mich darauf, im nächsten Jahr gemeinsam mit den Berliner Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten einen engagierten Wahlkampf zu führen", so Giffey.
Der Landesverband bestätigte dies: "Wir haben das heute Morgen auch noch einmal im geschäftsführenden Landesvorstand besprochen und sie unserer Solidarität versichert, und wir gehen fest davon aus, dass sie auch unsere Spitzenkandidatin wird", sagte der stellvertretende Landesvorsitzende und Innensenator Andreas Geisel.