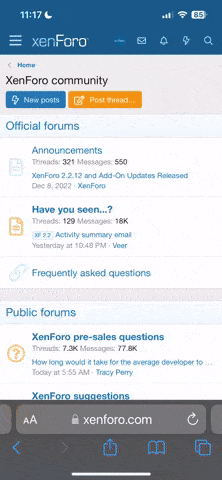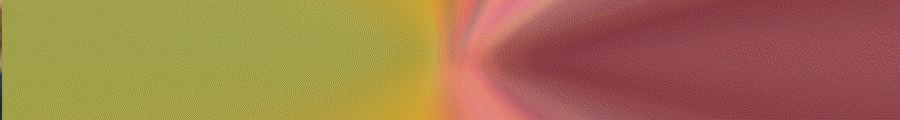collombo
MyBoerse.bz Pro Member
Schlappe für Boris Johnson: Britisches Oberhaus lehnt umstrittenes Binnenmarktgesetz ab !
Mit seinem Gesetz will der britische Premier den gültigen Brexit-Deal mit der EU aushebeln.
Nun hat Boris Johnson im britischen Oberhaus aber eine Schlappe einstecken müssen.
Das britische Oberhaus hat dem umstrittenen Binnenmarktgesetz, mit dem die Regierung den gültigen Brexit-Deal aushebeln will, erneut eine klare Abfuhr erteilt.
Das House of Lords stimmte am Montagabend in London mit überwältigender Mehrheit gegen die entscheidenden Klauseln, im ersten Votum mit 433 zu 165 Stimmen.
Premierminister Boris Johnson muss nun entscheiden, ob er dem Votum der Lords aus dem Oberhaus folgt oder nicht.
Eine erste Abstimmung über das Gesetz im Oktober war ähnlich klar ausgefallen.
Mehrere Abgeordnete argumentierten, das Gesetz würde den Frieden in Nordirland gefährden und dem internationalen Ansehen Großbritanniens in der Welt schaden.
Mit dem Gesetz will die Regierung von Premierminister Johnson Teile des bereits gültigen Austrittsabkommens zwischen London und der EU aushebeln.
Dies war auf starken Protest der Opposition und der Europäischen Union gestoßen.
Sie warfen Johnson Rechtsbruch vor und leiteten ein Verfahren wegen Verletzung des EU-Austrittsvertrags ein.
Unterhaus hatte mit deutlicher Mehrheit dafür gestimmt
Im Oberhaus sitzen viele Kritiker Johnsons.
Die Abgeordneten im Unterhaus hatten hingegen mit deutlicher Mehrheit für das Gesetz gestimmt.
Nun kommt es zu einer Art politischem Ping-Pong-Spiel zwischen dem Unter- und dem Oberhaus.
Aus der Regierung hieß es am Montag bereits, man werde das Gesetz nach Änderungen im Oberhaus wieder entsprechend umändern.
Das Gesetz könnte Sonderregeln für Nordirland im Brexit-Abkommen zunichte machen, die eine harte Grenze zum EU-Staat Irland und neue Feindseligkeiten dort verhindern sollen.
Johnson spricht von einem notwendigen "Sicherheitsnetz" – auch nach der US-Wahl noch.
Neuer gewählter US-Präsident Biden könnte Johnson im Weg stehen
Oppositionsführer Keir Starmer hatte Johnson nach dem Sieg des US-Demokraten Joe Biden aufgefordert, das Gesetz zu entschärfen.
"Wir werden bald einen Präsidenten im Oval Office haben, der ein passionierter Vertreter des Karfreitagsabkommens ist", schrieb der Chef der Labour-Partei in einem Gastbeitrag für den "Guardian".
Mit dem Karfreitagsabkommen wurde 1998 der jahrzehntelange, blutige Nordirlandkonflikt beendet. "
Wie Regierungen in aller Welt wird er es missbilligen, wenn unser Premierminister damit weitermacht, dieses Abkommen zu untergraben."
Der gewählte US-Präsident Biden hat irische Wurzeln: Sein Ururgroßvater wanderte aus Irland in die USA aus.
Zum Jahreswechsel endet die Brexit-Übergangsphase, in der weitgehend noch alles beim Alten geblieben ist.
London und Brüssel ringen derzeit noch immer um einen Handelspakt ab 2021.
Ohne Vertrag drohen Zölle und andere Handelshürden.
Mit seinem Gesetz will der britische Premier den gültigen Brexit-Deal mit der EU aushebeln.
Nun hat Boris Johnson im britischen Oberhaus aber eine Schlappe einstecken müssen.
Das britische Oberhaus hat dem umstrittenen Binnenmarktgesetz, mit dem die Regierung den gültigen Brexit-Deal aushebeln will, erneut eine klare Abfuhr erteilt.
Das House of Lords stimmte am Montagabend in London mit überwältigender Mehrheit gegen die entscheidenden Klauseln, im ersten Votum mit 433 zu 165 Stimmen.
Premierminister Boris Johnson muss nun entscheiden, ob er dem Votum der Lords aus dem Oberhaus folgt oder nicht.
Eine erste Abstimmung über das Gesetz im Oktober war ähnlich klar ausgefallen.
Mehrere Abgeordnete argumentierten, das Gesetz würde den Frieden in Nordirland gefährden und dem internationalen Ansehen Großbritanniens in der Welt schaden.
Mit dem Gesetz will die Regierung von Premierminister Johnson Teile des bereits gültigen Austrittsabkommens zwischen London und der EU aushebeln.
Dies war auf starken Protest der Opposition und der Europäischen Union gestoßen.
Sie warfen Johnson Rechtsbruch vor und leiteten ein Verfahren wegen Verletzung des EU-Austrittsvertrags ein.
Unterhaus hatte mit deutlicher Mehrheit dafür gestimmt
Im Oberhaus sitzen viele Kritiker Johnsons.
Die Abgeordneten im Unterhaus hatten hingegen mit deutlicher Mehrheit für das Gesetz gestimmt.
Nun kommt es zu einer Art politischem Ping-Pong-Spiel zwischen dem Unter- und dem Oberhaus.
Aus der Regierung hieß es am Montag bereits, man werde das Gesetz nach Änderungen im Oberhaus wieder entsprechend umändern.
Das Gesetz könnte Sonderregeln für Nordirland im Brexit-Abkommen zunichte machen, die eine harte Grenze zum EU-Staat Irland und neue Feindseligkeiten dort verhindern sollen.
Johnson spricht von einem notwendigen "Sicherheitsnetz" – auch nach der US-Wahl noch.
Neuer gewählter US-Präsident Biden könnte Johnson im Weg stehen
Oppositionsführer Keir Starmer hatte Johnson nach dem Sieg des US-Demokraten Joe Biden aufgefordert, das Gesetz zu entschärfen.
"Wir werden bald einen Präsidenten im Oval Office haben, der ein passionierter Vertreter des Karfreitagsabkommens ist", schrieb der Chef der Labour-Partei in einem Gastbeitrag für den "Guardian".
Mit dem Karfreitagsabkommen wurde 1998 der jahrzehntelange, blutige Nordirlandkonflikt beendet. "
Wie Regierungen in aller Welt wird er es missbilligen, wenn unser Premierminister damit weitermacht, dieses Abkommen zu untergraben."
Der gewählte US-Präsident Biden hat irische Wurzeln: Sein Ururgroßvater wanderte aus Irland in die USA aus.
Zum Jahreswechsel endet die Brexit-Übergangsphase, in der weitgehend noch alles beim Alten geblieben ist.
London und Brüssel ringen derzeit noch immer um einen Handelspakt ab 2021.
Ohne Vertrag drohen Zölle und andere Handelshürden.