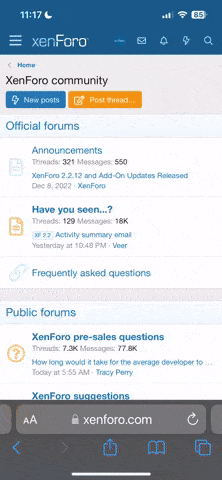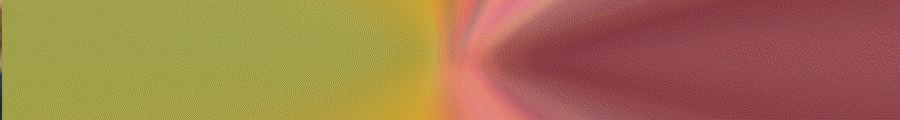collombo
MyBoerse.bz Pro Member
BGH-Urteil: Kunden können Kreditverträge noch nach Jahren kündigen !
Die Sparkassen sind über eine Fußnote in ihren Widerrufsbelehrungen gestolpert: Ein BGH-Urteil hat Hunderten Kunden die Kündigung von Kreditverträgen auch nach Jahren noch erlaubt.
Im jahrelangen Streit zwischen Banken und Kreditkunden um falsche Widerrufsbelehrungen haben die Geldhäuser eine Niederlage erlitten.
Der Bundesgerichtshof (BGH) hat am Donnerstag entschieden, dass Kunden noch nach Jahren ihre Kreditverträge kündigen können, sofern die Widerrufsbelehrung im Vertrag Fehler enthielt.
Die Sparkasse Nürnberg wurde dazu verurteilt, einen Darlehensvertrag aus dem Jahr 2008 rückabzuwickeln.
Die Grundsatzentscheidung vom Dienstag hat Auswirkungen auf zahlreiche Prozesse um den Widerruf von Altverträgen.
Denn mit dem am Dienstag verkündeten Urteil können nun hunderte Sparkassen-Kunden aus teuren Kreditverträgen aussteigen - allerdings nur, wenn sie diese vor dem 22. Juni 2016 widerrufen haben. (Az. XI ZR 564/15)
Die Kläger im Ausgangsfall hatten 2008 von der Sparkasse Nürnberg einen Verbraucherkredit über 50.000 Euro aufgenommen und ihn 2013 widerrufen, weil die Belehrung der Sparkasse zum Widerrufsrecht fehlerhaft gewesen sei.
Der Musterbelehrung der Sparkasse zufolge sollte die 14-tägige Widerrufsfrist „frühestens mit Erhalt dieser Belehrung“ beginnen.
In einer zusätzlichen Fußnote hieß es zudem: „Bitte Frist im Einzelfall prüfen“.
Der BGH erklärte diese von Sparkassen früher bundesweit genutzte Widerrufsbelehrung nun für irreführend, weil beim Kunden damit der Eindruck erweckt werden könne, dass die 14-tägige Frist je nach Umständen länger oder kürzer dauern kann.
Nach Angaben der auf solche Fälle spezialisierten Rechtsanwaltskanzlei Werdermann von Rüden findet sich diese fehlerhafte Widerrufsbelehrung bundesweit in etwa 30.000 Kreditverträgen, die von Ende 2002 bis Ende 2008 mit Sparkassen abgeschlossen wurden.
Allerdings können nur noch einige hundert Verbraucher, die rechtzeitig geklagt haben, ihre teuren Kreditverträge rückabwickeln, weil das sogenannte ewige Widerrufsrecht, das bei fehlerhaften Belehrungen galt, vom Gesetzgeber zum 22. Juni 2016 abgeschafft wurde.
Die Sparkassen sind über eine Fußnote in ihren Widerrufsbelehrungen gestolpert: Ein BGH-Urteil hat Hunderten Kunden die Kündigung von Kreditverträgen auch nach Jahren noch erlaubt.
Im jahrelangen Streit zwischen Banken und Kreditkunden um falsche Widerrufsbelehrungen haben die Geldhäuser eine Niederlage erlitten.
Der Bundesgerichtshof (BGH) hat am Donnerstag entschieden, dass Kunden noch nach Jahren ihre Kreditverträge kündigen können, sofern die Widerrufsbelehrung im Vertrag Fehler enthielt.
Die Sparkasse Nürnberg wurde dazu verurteilt, einen Darlehensvertrag aus dem Jahr 2008 rückabzuwickeln.
Die Grundsatzentscheidung vom Dienstag hat Auswirkungen auf zahlreiche Prozesse um den Widerruf von Altverträgen.
Denn mit dem am Dienstag verkündeten Urteil können nun hunderte Sparkassen-Kunden aus teuren Kreditverträgen aussteigen - allerdings nur, wenn sie diese vor dem 22. Juni 2016 widerrufen haben. (Az. XI ZR 564/15)
Die Kläger im Ausgangsfall hatten 2008 von der Sparkasse Nürnberg einen Verbraucherkredit über 50.000 Euro aufgenommen und ihn 2013 widerrufen, weil die Belehrung der Sparkasse zum Widerrufsrecht fehlerhaft gewesen sei.
Der Musterbelehrung der Sparkasse zufolge sollte die 14-tägige Widerrufsfrist „frühestens mit Erhalt dieser Belehrung“ beginnen.
In einer zusätzlichen Fußnote hieß es zudem: „Bitte Frist im Einzelfall prüfen“.
Der BGH erklärte diese von Sparkassen früher bundesweit genutzte Widerrufsbelehrung nun für irreführend, weil beim Kunden damit der Eindruck erweckt werden könne, dass die 14-tägige Frist je nach Umständen länger oder kürzer dauern kann.
Nach Angaben der auf solche Fälle spezialisierten Rechtsanwaltskanzlei Werdermann von Rüden findet sich diese fehlerhafte Widerrufsbelehrung bundesweit in etwa 30.000 Kreditverträgen, die von Ende 2002 bis Ende 2008 mit Sparkassen abgeschlossen wurden.
Allerdings können nur noch einige hundert Verbraucher, die rechtzeitig geklagt haben, ihre teuren Kreditverträge rückabwickeln, weil das sogenannte ewige Widerrufsrecht, das bei fehlerhaften Belehrungen galt, vom Gesetzgeber zum 22. Juni 2016 abgeschafft wurde.