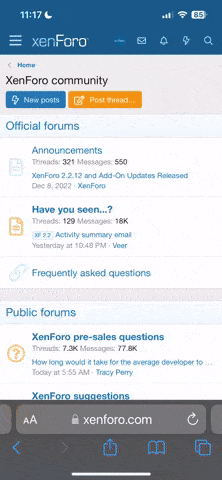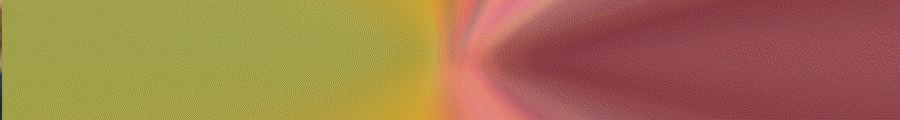collombo
MyBoerse.bz Pro Member
Zelle zu klein: Häftling will Freistaat Bayern verklagen !
Karlsruhe - Ein bayerischer Strafhäftling will den Freistaat wegen einer angeblich menschenunwürdigen Unterbringung im Gefängnis verklagen und hat hierbei einen ersten Erfolg beim Bundesverfassungsgericht erzielt.
Die Karlsruher Richter gaben einer Verfassungsbeschwerde des Mannes statt und verwiesen den Fall zurück an das Landgericht Augsburg, wie das Verfassungsgericht am Freitag berichtete.
Der Kläger kritisiert, dass er 2013 etwa ein halbes Jahr lang mit drei weiteren Gefangenen in zwei Zellen von jeweils 16 Quadratmetern untergebracht gewesen sei.
Er bemängelt, dass dieser Platz für vier Häftlinge nicht ausreichend gewesen sei.
Die Augsburger Richter müssen nun erneut über einen Antrag auf Prozesskostenhilfe entscheiden, damit der Kläger einen Prozess gegen den Freistaat finanzieren kann.
Das Landgericht und auch das Oberlandesgericht München hatten diesen Antrag zunächst abgelehnt, weil die Richter in der angestrebten Amtshaftungsklage keine Aussicht auf Erfolg sahen.
Das Bundesverfassungsgericht bewertete dies nun anders.
Im konkreten Fall müsse die Frage, ob vier Quadratmeter pro Häftling menschenwürdig sind, in einem Hauptverfahren geklärt werden (Az.: 1 BvR3359/14
Klare Vorgaben für die menschenwürdige Unterbringung von Gefangenen in Gemeinschaftszellen fehlen nach Ansicht der Richter allerdings bisher.
Karlsruhe - Ein bayerischer Strafhäftling will den Freistaat wegen einer angeblich menschenunwürdigen Unterbringung im Gefängnis verklagen und hat hierbei einen ersten Erfolg beim Bundesverfassungsgericht erzielt.
Die Karlsruher Richter gaben einer Verfassungsbeschwerde des Mannes statt und verwiesen den Fall zurück an das Landgericht Augsburg, wie das Verfassungsgericht am Freitag berichtete.
Der Kläger kritisiert, dass er 2013 etwa ein halbes Jahr lang mit drei weiteren Gefangenen in zwei Zellen von jeweils 16 Quadratmetern untergebracht gewesen sei.
Er bemängelt, dass dieser Platz für vier Häftlinge nicht ausreichend gewesen sei.
Die Augsburger Richter müssen nun erneut über einen Antrag auf Prozesskostenhilfe entscheiden, damit der Kläger einen Prozess gegen den Freistaat finanzieren kann.
Das Landgericht und auch das Oberlandesgericht München hatten diesen Antrag zunächst abgelehnt, weil die Richter in der angestrebten Amtshaftungsklage keine Aussicht auf Erfolg sahen.
Das Bundesverfassungsgericht bewertete dies nun anders.
Im konkreten Fall müsse die Frage, ob vier Quadratmeter pro Häftling menschenwürdig sind, in einem Hauptverfahren geklärt werden (Az.: 1 BvR3359/14
Klare Vorgaben für die menschenwürdige Unterbringung von Gefangenen in Gemeinschaftszellen fehlen nach Ansicht der Richter allerdings bisher.