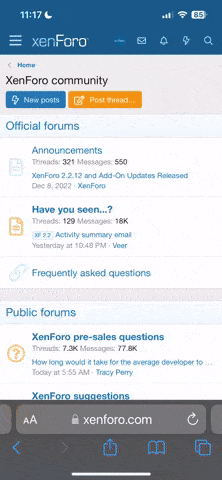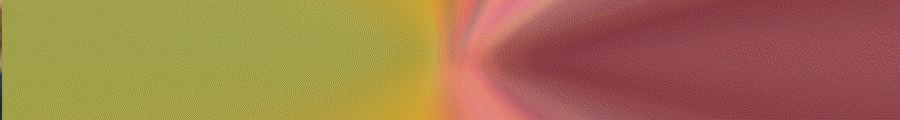collombo
MyBoerse.bz Pro Member
Affäre um „NSU 2.0“: Rechte Zelle in Landespolizei ? Jetzt kündigt Bundesinnenminister Seehofer Schritte an !
In der „NSU 2.0“-Affäre um die Polizei Hessen ist bereits der Polizeipräsident zurückgetreten.
Nun kündigt Horst Seehofer (CSU) eine Reaktion an.
69 Drohmails an 27 Personen wurden von der selbsternannten „NSU 2.0“ verschickt.
Doch woher haben die Rechtsextremisten die sensiblen Informationen über ihre Opfer?
Die hessische Polizei ist unter Verdacht der Mithilfe geraten als bekannt wurde, dass die nicht-öffentlichen Daten einiger Betroffener kurze Zeit vor dem Eingang der NSU-Schreiben von Dienstcomputern abgefragt worden waren.
„Wer als Polizist Daten abfragt und diese für Straftaten wie Morddrohungen zur Verfügung stellt, ist selbst ein Fall für die Staatsanwaltschaft und muss sofort entlassen werden“, verurteilt Linken-Fraktionschef André Hahn die mutmaßlichen illegalen Abfragen zutiefst.
Wegen des unberechtigten Zugriffs auf Daten hatte es 2018 laut Informationen der „Welt am Sonntag" bundesweit über 400 Odnungswidrigkeits-, Straf- oder Disziplinarverfahren gegen Polizeibeamte gegeben.
Die Kontrollmechanismen diesbezüglich weichen von Land zu Land stark voneinander ab und stellen sich teilweise nur äußerst stichprobenartig dar.
In Baden-Württemberg müsse jede 50. Abfrage begründet werden, in Hessen nur jeder 200. Zugriff, heißt es.
Konstantin Kuhle, Innenexperte der FDP, klagt, das Vertrauen in die Sicherheitsbehörden werde durch die Verstöße erschüttert.
„Die Innenminister von Bund und Ländern müssen sicherstellen, dass unbefugte Datenabfragen sofort gestoppt werden“, fordert er.
Auch die Aufklärung, die aktuell häufig sehr schleppend vor sich geht, müsse unbedingt verbessert werden.
Bundesinnenminster Horst Seehofer (CSU) will nicht untätig bleiben.
„Ich werde prüfen, ob der Zugriff auf Polizeidatenbanken mit biometrischen Merkmalen besseren Schutz ermöglicht“, kündigt er an,
„Datenzugriffe sind eine sehr sensible Angelegenheit und sollten deshalb mit den höchsten Standards geschützt sein.“
Sollte sich der Verdacht einer rechten Zelle innerhalb der Polizei Hessen allerdings bewahrheiten, dürften noch deutlich massivere Schritte notwendig werden.
In der „NSU 2.0“-Affäre um die Polizei Hessen ist bereits der Polizeipräsident zurückgetreten.
Nun kündigt Horst Seehofer (CSU) eine Reaktion an.
69 Drohmails an 27 Personen wurden von der selbsternannten „NSU 2.0“ verschickt.
Doch woher haben die Rechtsextremisten die sensiblen Informationen über ihre Opfer?
Die hessische Polizei ist unter Verdacht der Mithilfe geraten als bekannt wurde, dass die nicht-öffentlichen Daten einiger Betroffener kurze Zeit vor dem Eingang der NSU-Schreiben von Dienstcomputern abgefragt worden waren.
„Wer als Polizist Daten abfragt und diese für Straftaten wie Morddrohungen zur Verfügung stellt, ist selbst ein Fall für die Staatsanwaltschaft und muss sofort entlassen werden“, verurteilt Linken-Fraktionschef André Hahn die mutmaßlichen illegalen Abfragen zutiefst.
Wegen des unberechtigten Zugriffs auf Daten hatte es 2018 laut Informationen der „Welt am Sonntag" bundesweit über 400 Odnungswidrigkeits-, Straf- oder Disziplinarverfahren gegen Polizeibeamte gegeben.
Die Kontrollmechanismen diesbezüglich weichen von Land zu Land stark voneinander ab und stellen sich teilweise nur äußerst stichprobenartig dar.
In Baden-Württemberg müsse jede 50. Abfrage begründet werden, in Hessen nur jeder 200. Zugriff, heißt es.
Konstantin Kuhle, Innenexperte der FDP, klagt, das Vertrauen in die Sicherheitsbehörden werde durch die Verstöße erschüttert.
„Die Innenminister von Bund und Ländern müssen sicherstellen, dass unbefugte Datenabfragen sofort gestoppt werden“, fordert er.
Auch die Aufklärung, die aktuell häufig sehr schleppend vor sich geht, müsse unbedingt verbessert werden.
Bundesinnenminster Horst Seehofer (CSU) will nicht untätig bleiben.
„Ich werde prüfen, ob der Zugriff auf Polizeidatenbanken mit biometrischen Merkmalen besseren Schutz ermöglicht“, kündigt er an,
„Datenzugriffe sind eine sehr sensible Angelegenheit und sollten deshalb mit den höchsten Standards geschützt sein.“
Sollte sich der Verdacht einer rechten Zelle innerhalb der Polizei Hessen allerdings bewahrheiten, dürften noch deutlich massivere Schritte notwendig werden.