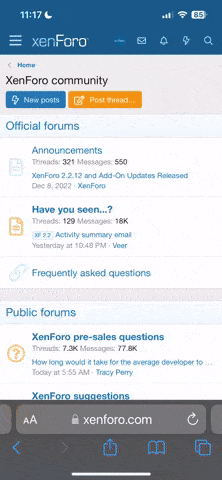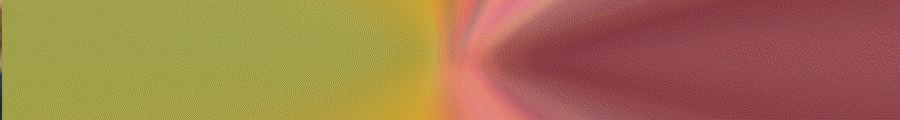Putschversuch in der Türkei: Wusste Erdogan von der Verschwörung !
Vor vier Jahren bricht in der Türkei das Chaos aus.
Panzer rollen über die Straßen von Istanbul, Erdogan entkommt nur knapp einem Spezialkommando.
Doch was wusste die Regierung im Vorfeld des Staatsstreichs?
Soldaten mit Maschinengewehren und Panzer sperren wichtige Straßen und Brücken in Istanbul, Kampfflugzeuge donnern im Tiefflug über Ankara, lassen Fensterscheiben bersten.
Große Explosionen erschüttern die türkischen Metropolen, Teile der türkischen Armee schießen auf Zivilisten.
Diese Bilder schockieren in der Nacht vom 15. auf den 16. Juli 2016 die ganze Welt.
Der Putschversuch scheitert innerhalb weniger Stunden, aber die damaligen Ereignisse prägen und spalten die Türkei bis heute.
Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan führt seitdem einen Krieg gegen die Gülen-Bewegung, die er für den Putschversuch verantwortlich macht.
Die Säuberungen weiteten sich schnell auf Oppositionelle und andere Regierungskritiker aus.
Im Schatten dieser Jagd baute Erdogan seine Macht im Land immer weiter aus, seine Partei AKP verhinderte teilweise die Aufklärung des Putschversuches.
Der Angriff der Putschisten auf den Präsidenten war die Explosion des Machtkampfes, der schon mehrere Jahre zwischen Erdogan und dem islamischen Prediger Fethullah Gülen tobte.
Der türkische Präsident nutzt seinen Sieg über die Putschisten für eine gnadenlose Säuberungsaktion, um sich seiner politischen Gegner zu entledigen.
Auch deshalb werfen ihm Kritiker vor, dass er den Putschversuch gezielt zugelassen habe, um seine Macht weiter auszubauen.
Die Massenverhaftungen und Entlassungen im Land verzerren außerdem das Bild der Nacht, in der sich viele unbewaffnete Zivilisten trotz Lebensgefahr der Armee entgegenstellten.
Noch vier Jahre danach gibt es viele offene Fragen und Widersprüche, die eigentlich nur die türkische Regierung aufklären kann.
Um das zu verstehen, ist ein Rückblick auf die Stunden nötig, die die Türkei nachhaltig veränderten:
Planungstreffen in Ankara
Der Putschversuch wurde von der türkischen Staatsanwaltschaft rekonstruiert.
Die Untersuchungsberichte und Anklageschriften sind mit Vorsicht zu genießen, da Erdogans AKP Einfluss auf die Justiz nahm.
Dennoch geben Polizeiberichte, Aussagen aus dem Militär und weitere Zeugenaussagen ein ausführliches Bild von der Putschnacht und den Ereignissen zuvor.
Ein gefährliches Untergrundnetzwerk
Nach dem jahrelangen Machtkampf mit Erdogan steht Gülen schon im Jahr 2016 mit dem Rücken zur Wand.
Seine Bewegung gerät immer mehr unter Druck, verlor schon drei Jahre vor dem Umsturzversuch durch Säuberungsaktionen wichtige Positionen im Staat und damit auch an Einfluss.
Gülens Hizmet-Bewegung galt davor in der Türkei als Staat im Staat.
Seit 1981 schaffte es die islamische Bewegung, die von ihren Kritikern auch als Sekte angesehen wird, den türkischen Staat systematisch zu unterwandern.
So besetzten Gülen-Anhänger wichtige Posten in der Armee, Polizei und in der Justiz.
Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch spricht von gefährlichen Strukturen, die das Gülen-Netzwerk in der Türkei unterhielt.
Doch einen erheblichen Machtzuwachs erreichte Gülen erst seit der Machtübernahme der islamisch-konservativen AKP im Jahr 2002.
Die Verbindungen zwischen der Bewegung und der Partei waren eng: Gülen unterhält weltweit ein Netzwerk aus Schulen und Bildungseinrichtungen und auch viele führende AKP-Politiker schickten ihre Kinder auf Gülen-Schulen.
Diese enge Verbindung bestätigte Erdogan selbst: "Welche eurer Wünsche haben wir nicht erfüllt?", sagte er im Jahr 2013, als sich das Verhältnis zwischen ihm und und der Bewegung langsam verschlechterte.
Auch Erdogan und Gülen waren anfangs Weggefährten, bis Erdogan den Prediger beschuldigte, selbst die Staatsführung übernehmen zu wollen.
Aber Gülen floh schon im Jahr 1999 in den US-Bundesstaat Pennsylvania, weil er wegen Unterwanderung des Staates angeklagt wurde.
Dort lebt er bis heute, was in der türkischen Bevölkerung den Vorwurf nährt, dass die USA Gülen unterstützt hätten, weil sie in der islamischen Bewegung im Kalten Krieg ein Gegengewicht zum Einfluss linker Bewegungen und der Sowjetunion in der Türkei sahen.
Und in der Tat sagten auch zwei CIA-Agenten zugunsten Gülens aus, als ein US-Gericht über seine Aufenthaltsgenehmigung entscheiden musste.
Einigkeit bei den Verantwortlichen
Das Motiv der Gülen-Bewegung für den Putschversuch ist klar: Durch die Verfolgung durch Erdogan sah man sich zum Handeln gezwungen, weil man Jahre später gar nicht mehr die Kraft hätte aufbringen können, eine solche Unternehmung zu starten.
Deshalb ist man sich in der Türkei parteiübergreifend einig, dass Gülen für die Vorfälle am Abend des 15. Juli 2016 verantwortlich ist.
Auch in großen Teilen der türkischen Bevölkerung ist die Bewegung unbeliebt, weil sie den Staat infiltrierte.
Zivilisten applaudierten in Istanbul am Anfang des Putsches nur so lange, bis sie herausfanden, dass Gülen angeblich dahintersteckte.
Der versuchte Umsturz ist demnach eher eine Notgeburt, schlecht organisiert; die Teile des Militärs, die sich den Putschisten anschließen, wirken überfordert.
Armee als Hüter des Laizismus
Das ausrückende Militär im Land weckt in der Türkei traurige Erinnerungen.
Schon in den Sechzigern, Siebzigern und zuletzt im Jahr 1980 gab es blutige Militärputsche, Generäle übernahmen die Macht und änderten teilweise die Verfassung.
Das führte zu Gewalt, Folter und vor allem zu Repressionen gegen gläubige Muslime.
Darin liegt wiederum auch der Grund für die Beliebtheit der Armee in Teilen der türkischen Bevölkerung.
Die Armee sieht sich traditionell als Hüter des Laizismus in der Türkei, nach der kemalistischen Tradition des Staatsgründers Mustafa Kemal Atatürk also die strikte Trennung von Staat und Religion.
Damit können sich vor allem die Türkinnen und Türken identifizieren, die der zunehmenden Islamisierung der Politik durch Erdogan kritisch gegenüberstehen.
Die Flucht Erdogans als Wendepunkt
Als sich zunächst durch die sozialen Medien verbreitet, wer hinter dem Putschversuch stecken soll, gehen, neben Erdogan-Anhängern, auch zahlreiche Oppositionelle auf die Straße.
Um 23 Uhr fallen in Istanbul Schüsse auf Demonstranten, Soldaten feuern in eine protestierende Menschenmenge – reglose Körper und verwundete Menschen liegen auf der Zufahrt zur ersten Bosporusbrücke der Metropole.
In anderen Stadtteilen kommt die demonstrierende Menschenmasse den Soldaten nahe, beschimpft sie, die meist jungen Soldaten wirken mit der Situation überfordert, viele Soldaten stehen tatenlos herum.
Präsident Erdogan ist zu Beginn des Putschversuches mit seiner Familie im Urlaub, in einem Hotel in Marmaris, im Südwesten der Türkei.
Dort will er laut Regierungsangaben erst um 22 Uhr von "Vorfällen in der Armee" erfahren haben.
Er verlässt darauf umgehend mit seiner Familie das Hotel, gibt ein Fernsehinterview, was zunächst, angeblich aus technischen Gründen, nicht gesendet werden kann.
Kurz vor Mitternacht wird die TRT-Nachrichtensprecherin von den Putschisten gezwungen, eine Nachricht zu verlesen.
"Der Rat des Friedens" habe die Macht übernommen.
Der Name ist eine Anspielung auf die Parole des türkischen Staatsgründers Atatürk "Frieden im Land, Frieden in der Welt".
Nun gibt es Gewissheit für die schockierte türkische Bevölkerung: Es handelt sich um einen Putsch.
Kurz darauf meldet sich auch Erdogan per Facetime-Anruf beim Nachrichtensender CNN Türk.
Seine Reaktion auf die Vorkommnisse wird auf allen türkischen Sendern ausgestrahlt.
Er ruft die Bevölkerung dazu auf, "sich im Namen der Demokratie gegen die Putschisten zu stellen, auf öffentlichen Plätzen zu versammeln und den Atatürk-Flughafen wieder einzunehmen".
Tausende Menschen strömen nach dieser Aufforderung auf die Straße, es ist der Wendepunkt der Putschnacht.
Stürmung von Erdogans Hotelzimmer
Um 3 Uhr kommt eine Spezialeinheit der Putschisten mit einem Hubschrauber in Erdogans Hotel in Marmaris an, bei der Erstürmung seines Hotelzimmers werden zwei Polizisten getötet, die zum Schutz des Präsidenten abgestellt sind.
Der Präsident wird nach dem Putschversuch von einem Mordkomplott gegen ihn sprechen – einer Tötung, der er entkommen sei.
20 Minuten nachdem das Spezialkommando an dem Hotel eintrifft, landet Erdogan schon am Atatürk-Flughafen, den Demonstranten bereits zurückerobert haben.
Nach seiner Landung lässt er sich von seinen Anhängern feiern.
Trotz der mangelnden Unterstützung für den Putsch aus der Bevölkerung fallen weiterhin Schüsse, bis zum Morgen kämpfen Teile der Armee weiter gegen meist unbewaffnete Demonstranten und Polizisten in Ankara und Istanbul.
Helikopter beschießen die Zentrale des Geheimdienstes MIT, ein Kampfflugzeug feuert noch am Morgen des 16. Juli eine Rakete in das türkische Parlament in Ankara.
Aber eine Stunde später ergeben sich gegen 7 Uhr auch die letzten Soldaten in den türkischen Metropolen der Übermacht an Zivilisten und der Polizei.
Der Putschversuch ist misslungen, Erdogan hat gewonnen.
Was wusste die AKP-Regierung?
Doch der eigentliche Kampf gegen die Gülen-Bewegung beginnt erst mit dem Scheitern des Putsches.
Die türkische Politik zeigt nach dem Sieg über die Putschisten zunächst Einigkeit, die Geschehnisse sind für viele Türkinnen und Türken bis heute traumatisch.
Über 250 Menschen kommen in der Putschnacht ums Leben, unter den Opfern sind knapp 180 Zivilisten.
Die Gewalt erzeugt Gegengewalt. Soldaten, die sich zuvor ergeben hatten, werden auf offener Straße geschlagen und misshandelt.
Später wird ein Soldat vor Gericht erzählen, dass er von der Polizei mit einem Knüppel vergewaltigt wurde.
Doch so einig sich die türkischen Parteien kurz nach dem Putschversuch sind, so uneinig sind sich Opposition und AKP-Regierung darüber, wie viel Erdogan und sein engster Kreis im Vorfeld über die Pläne der Putschisten gewusst haben.
Das türkische Parlament setzt schnell einen Untersuchungsausschuss an, aber die AKP besetzt alle entscheidenden Posten.
Erdogans Partei verhindert im Anschluss, dass zum Beispiel Hulusi Akar, Kommandant des Heeres, oder der Geheimdienstchef Hakan Fidan vor dem Ausschuss aussagen müssen – zum Unmut der anderen Parteien.
Durch ihre gehobene Stellung wären Warnungen vor einem Putsch auf ihren Schreibtischen gelandet.
Dazu gibt bis zum heutigen Tag keine Stellungnahme.
Doch es gab zumindest eine Warnung: Die Geschichte eines Luftwaffenpiloten sorgt während der Untersuchung der Vorfälle in der Türkei für Aufsehen.
Der ehemalige Gülen-Anhänger Osman Karaca warnte offenbar den türkischen Geheimdienst am Morgen des versuchten Staatsstreiches.
Am Nachmittag des 15. Juli soll er von vier MIT-Beamten verhört worden sein.
Sie fragten ihn, was er erwarte.
Er antwortete: "Es wird eine große Aktion geben, womöglich einen Putsch."
Geheimdienstchef Fidan, der als enger Vertrauter Erdogans gilt, sagte jedoch, dass er den Präsidenten nicht informiert habe.
Warum?
Auch diese Frage hat Fidan bis heute nicht beantwortet.
Die türkische Regierung bestreitet die Warnung nicht, aber sie habe den Präsidenten angeblich nicht erreicht.
Die AKP argumentiert, dass es oft Gerüchte über Umsturzversuche gab und Erdogan nicht immer informiert werden würde.
Doch die Opposition begründet ihren Zweifel damit, dass Erdogan in der Türkei so viel Macht und Kontrolle ausübt, dass er in dem Fall darüber umgehend informiert worden wäre.
Säuberungsaktionen der Regierung
Aber eine umfassende Aufklärung dieser Schicksalsnacht ist nicht in Sicht.
Fest steht jedoch, dass Erdogan in den folgenden Jahren politisch von dem Putschversuch profitiert.
Nach dem Sieg bezeichnet er den Angriff der Putschisten als "Segen Gottes", was zusätzlich für Irritationen in der Türkei sorgt.
Das sei nun der Grund, die Streitkräfte "zu säubern".
Schnell kursieren in der Öffentlichkeit Gerüchte über mögliche Listen von mutmaßlichen Gülen-Anhängern, die schon im Vorfeld in Schubladen gewesen sein sollen und nun herausgeholt werden.
Bis heute stehen die Jahre nach dem Putschversuch im Zeichen des Krieges gegen die Gülen-Bewegung.
Es herrscht der Ausnahmezustand: Insgesamt werden über 500.000 Menschen festgenommen und teilweise nach einer langen Untersuchungshaft wieder freigelassen.
Über 130.000 Staatsbedienstete – Polizisten, Soldaten, Lehrer, Dozenten – verlieren ihre Jobs.
Unter den Terrorbeschuldigten sind auch viele Linke, Oppositionelle, Erdogan-Kritiker, Gewerkschaftler und Medien.
Es herrscht nach 2016 eine Mischung aus Trauma und Angst im Land.
Im Schatten all dieser Ereignisse erreicht Erdogan den Zenit seiner Macht.
Er gewann im Jahr 2017 das Verfassungsreferendum, was ihm im neuen Präsidialsystem noch mehr Macht sichert.
Der Präsident, der den Putschversuch eigentlich als "Angriff auf die Einheit der Türkei" bezeichnet, tut in den Jahren danach viel, um das Land zu spalten und sich somit mehr Macht zu sichern.
Diese Spaltung sorgt vor allem dafür, dass sich die Gräben zwischen den politischen Lagern vertiefen und dass die AKP ihre Anhängerschaft noch enger an sich binden kann.
Es führt in vielen türkischen Familien auch dazu, dass Familienmitglieder nicht mehr miteinander reden, wenn sie unterschiedliche politische Einstellungen haben.
Die regierende AKP habe die Türkei nach dem 15. Juli 2016 in ein "furchtbar undemokratisches System" geführt, sagt Sezgin Tanrikulu, Abgeordneter der größten Oppositionspartei CHP, zum vierjährigen Jubiläum des Sieges über die Putschisten.
"Alle Freiheiten und Rechte werden ungehemmt und willkürlich abgeschafft", heißt es von dem stellvertretenden HDP-Fraktionsvorsitzenden Saruhan Oluc.
Die Bekämpfung der Gülen-Bewegung benutzt der türkische Staatspräsident auch vier Jahre nach dem Putschversuch noch für eine Hexenjagd auf politische Gegner, was dem Aufarbeitungsprozess des Putschversuches Glaubwürdigkeit nimmt.
Denn die wahren Putschisten sitzen nun zusammen mit nicht kriminellen Oppositionellen im Gefängnis.
Viele offene Fragen
Das führt vor allem auch zu Verwerfungen mit dem Ausland nach den Ereignissen von 2016.
Große Teile der türkischen Gesellschaft vermissen noch heute Solidarität, speziell von den Nato-Partnern EU und USA.
Die Vereinigten Staaten verhindern beispielsweise eine Auslieferung Gülens, der deutsche Bundesnachrichtendienst (BND) verkündet nach den Vorfällen in der Türkei öffentlich, dass man nicht glaube, dass die Gülen-Bewegung hinter dem Putschversuch stecke.
Und trotz der Gefahr, die von dem Netzwerk des Predigers ausgeht, erlaubt Deutschland weiterhin, dass die Schulen der Bewegung die Bundesrepublik als wichtigen Standort nutzen können.
Das trifft in der Türkei und auch bei vielen türkischstämmigen Menschen in Deutschland auf wenig Verständnis.
Auch dieses Misstrauen nutzt Erdogan dem Ausland gegenüber politisch, um sich in der türkischen Bevölkerung als starker Verteidiger seines Landes zu inszenieren.
Zum vierten Jahrestag des Putschversuches hat die Türkei Chaosjahre hinter sich, durch Lira- und Corona-Krise ist dabei aber noch kein Ende in Sicht.
Der Bevölkerung täte auch deshalb gut, wenn dem Trauma des 15. und 16. Juli mit Aufklärung und Transparenz begegnet würde, um der Angst Gesichter zu geben.
Zu der Nacht, in der es für Erdogan um alles ging, gibt es noch viele offene Fragen, aber es scheint momentan unwahrscheinlich, dass der Präsident diese jemals beantwortet haben will.