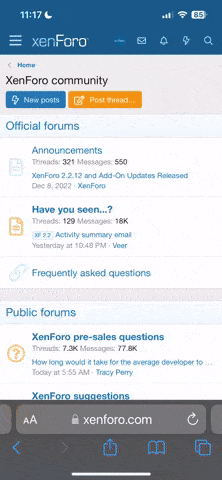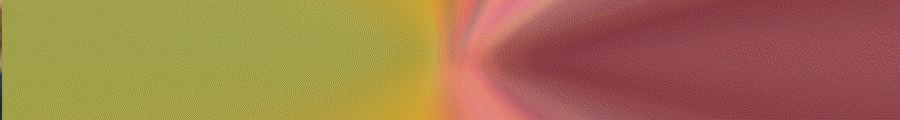collombo
MyBoerse.bz Pro Member
Hersteller von Aldi-Waschmittel ist pleite !
200 Mitarbeiter betroffen - Hersteller des Aldi-Waschmittels ist insolvent.
In der Corona-Krise ging der Bedarf an Waschmittel deutlich zurück.
Das merken auch die Hersteller.
Jetzt steht ein weiterer deutscher Produzent vor dem Aus.
Der Wasch- und Spülmittelproduzent Thurn Germany ist pleite.
Die Firma mit Standorten in Genthin (Sachsen-Anhalt), Neunkirchen (NRW) und Kerkaden (Niederlande) hat demnach bereits Ende vergangener Woche Insolvenz angemeldet.
Darüber berichten mehrere Medien.
Hintergrund der Pleite ist der starke Nachfragerückgang nach Waschmittel in der Corona-Krise.
So hieß es seitens Thurn Germany, dass im Lockdown Millionen Menschen nicht ins Fitnessstudio, zum Freizeitsport oder ins Restaurant gegangen seien, wo deshalb weniger Bedarf an sauberen Tischdecken herrschte.
Zuletzt hätten zudem die gestiegenen Rohstoffpreise Schwierigkeiten bereitet.
Die staatlichen Hilfen hätten nichts genutzt, so Geschäftsführer Peter Schoof – sein Unternehmen habe "nicht ins Raster gepasst".
Thurn Germany ist Produzent verschiedener Waschmittel und Spülseifen, die jedoch im Gegensatz zu den Marken großer Hersteller wie Henkel weniger bekannt sind.
So produziert Thurn Germany etwa das Aldi-Waschmittel Tandil und das Geschirrspülmittel Alio, das es ebenfalls bei Aldi Nord gibt.
Weiterer Hersteller ging zuletzt pleite
Thurn Germany ist das zweite Waschmittelunternehmen, das binnen kurzer Zeit Insolvenz anmelden musste.
Zuletzt ist bereits der Reinigerhersteller Sopronem, der Marken wie Putzmeister, Zekol, W5 oder Blik produziert, in die Knie gegangen.
Ob die drei Thurn-Germany-Standorte erhalten bleiben können, ist noch offen.
Der Insolvenzverwalter macht sich Berichten zufolge zunächst einen Überblick.
Insgesamt arbeiten bei Thurn Germany rund 200 Angestellte.
Für das Unternehmen ist es nicht die erste Pleite.
Bereits 2017 meldete die Firma Insolvenz an, damals musste Firmengründer Adolf Thurn in diesem Zuge gehen, die Firma wurde an zwei Familien verkauft.
200 Mitarbeiter betroffen - Hersteller des Aldi-Waschmittels ist insolvent.
In der Corona-Krise ging der Bedarf an Waschmittel deutlich zurück.
Das merken auch die Hersteller.
Jetzt steht ein weiterer deutscher Produzent vor dem Aus.
Der Wasch- und Spülmittelproduzent Thurn Germany ist pleite.
Die Firma mit Standorten in Genthin (Sachsen-Anhalt), Neunkirchen (NRW) und Kerkaden (Niederlande) hat demnach bereits Ende vergangener Woche Insolvenz angemeldet.
Darüber berichten mehrere Medien.
Hintergrund der Pleite ist der starke Nachfragerückgang nach Waschmittel in der Corona-Krise.
So hieß es seitens Thurn Germany, dass im Lockdown Millionen Menschen nicht ins Fitnessstudio, zum Freizeitsport oder ins Restaurant gegangen seien, wo deshalb weniger Bedarf an sauberen Tischdecken herrschte.
Zuletzt hätten zudem die gestiegenen Rohstoffpreise Schwierigkeiten bereitet.
Die staatlichen Hilfen hätten nichts genutzt, so Geschäftsführer Peter Schoof – sein Unternehmen habe "nicht ins Raster gepasst".
Thurn Germany ist Produzent verschiedener Waschmittel und Spülseifen, die jedoch im Gegensatz zu den Marken großer Hersteller wie Henkel weniger bekannt sind.
So produziert Thurn Germany etwa das Aldi-Waschmittel Tandil und das Geschirrspülmittel Alio, das es ebenfalls bei Aldi Nord gibt.
Weiterer Hersteller ging zuletzt pleite
Thurn Germany ist das zweite Waschmittelunternehmen, das binnen kurzer Zeit Insolvenz anmelden musste.
Zuletzt ist bereits der Reinigerhersteller Sopronem, der Marken wie Putzmeister, Zekol, W5 oder Blik produziert, in die Knie gegangen.
Ob die drei Thurn-Germany-Standorte erhalten bleiben können, ist noch offen.
Der Insolvenzverwalter macht sich Berichten zufolge zunächst einen Überblick.
Insgesamt arbeiten bei Thurn Germany rund 200 Angestellte.
Für das Unternehmen ist es nicht die erste Pleite.
Bereits 2017 meldete die Firma Insolvenz an, damals musste Firmengründer Adolf Thurn in diesem Zuge gehen, die Firma wurde an zwei Familien verkauft.