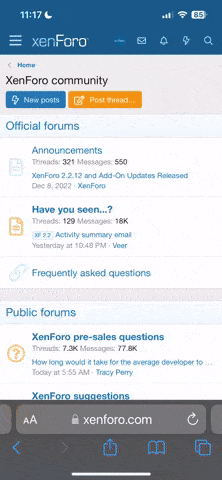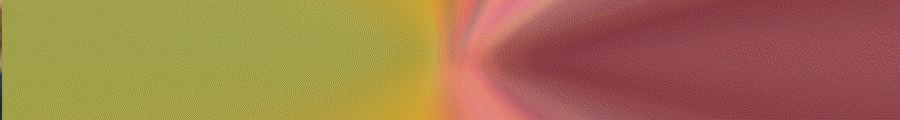Merkel ringt mit Ministerpräsidenten: Deutschland droht der Corona-Flickenteppich !
Am heutigen Mittwoch wollen die Länderchefs mit Angela Merkel über die richtige Exit-Strategie verhandeln.
Doch der Wille zu einer einheitlichen Linie bei den Lockerungen bröckelt.
Der wichtigste Ratgeber hat keinen Rat für Angela Merkel mitgebracht.
Lothar Wieler, der Chef des Robert Koch-Instituts, saß an diesem Dienstag mit ewig ernstem Blick vor einer blauen Wand und beantwortet die Fragen von Journalisten zur Corona-Krise.
Es ist ein wichtiger Termin, am Mittwoch telefonieren die Ministerpräsidenten mit Angela Merkel.
Sie müssen entscheiden, wie es weitergeht mit Deutschland, ob es nach den Osterferien Lockerungen geben kann und wenn ja, welche.
Doch Lothar Wieler sagt nur: "Die Entscheidung liegt nicht bei uns."
Politiker entscheiden in der Corona-Krise, nicht Wissenschaftler.
In normalen Zeiten ist das eine Selbstverständlichkeit, aber jetzt sind eben keine normalen Zeiten.
Politiker werden so stark von der Wissenschaft beraten wie wahrscheinlich nie zuvor.
Doch am Mittwoch, um 14 Uhr, da werden sie entscheiden müssen, sechzehn Ministerpräsidenten, die Kanzlerin und ihre wichtigsten Krisen-Minister.
Es wird eine Entscheidung sein, die wie alle politischen Entscheidungen nicht nur auf Sachgründen basiert, sondern auch auf Machtpolitik.
Und ob am Ende wirklich eine einheitliche Linie aller Bundesländer steht, ist völlig offen.
Derzeit sieht es eher nach einem Flickenteppich aus.
Von guten Gründen und kleinen Königen
Das Virus ist in Deutschland nicht gleichmäßig verteilt, die Pandemie breitet sich unterschiedlich aus: Am Dienstag gab es 33.569 Corona-Fälle in Bayern, und 872 Tote.
In Mecklenburg-Vorpommern waren es nur 619 Fälle und 11 Tote.
Auch die Ansteckungsquoten sind verschieden, genauso wie die wirtschaftlichen Einbußen.
All das haben die Ministerpräsidenten für ihr Land im Blick, danach entscheiden sie.
Für unterschiedliche Regelungen in unterschiedlichen Bundesländern kann es also gute Gründe geben.
Aber diese guten Gründe erklären nicht alle Unterschiede.
"Die Ministerpräsidenten sind aktuell kleine Könige, da nimmt sich jeder das Recht raus, eigene Entscheidungen zu treffen", sagte eine Funktionärin der CDU.
Es gibt Länderchefs, die schnellstmöglich zur Normalität zurückkehren wollen.
Die prominentesten von ihnen sind die CDU-Ministerpräsidenten von Nordrhein-Westfalen, Armin Laschet, und von Schleswig-Holstein, Daniel Günther.
Günther sagte bereits, in Schleswig-Holstein müsse man sich auf eine "Phase des Hochfahrens" einstellen.
Laschet drängt auf Lockerungen
Laschet wurde in seiner Fernsehansprache am Ostersonntag noch deutlicher: Er erklärte, man könne mit mehr Wissen über das Virus "in eine neue Phase unseres Miteinanders eintreten".
Und zwar mit "vielen kleinen, vorsichtigen Schritten".
Das war kein Befreiungsschlag, doch eine markante Botschaft: Jetzt geht es langsam zurück in die Normalität.
Angedeutet hatte Laschet seinen Drang zum Exit schon in den Tagen zuvor.
Doch zu Beginn der Pandemie hatte er bei der Verhängung von Kontaktbeschränkungen noch gezögert.
Das war schlecht fürs Marketing in eigener Sache, denn trotz der Krise geht das Rennen um den CDU-Vorsitz weiter.
Laschet war im Kampf gegen Friedrich Merz und Norbert Röttgen eigentlich der Favorit, doch dann kam Corona.
Seine jetzige Haltung dürfte also auch von Taktik geprägt sein.
Um seinen Willen zu Lockerungen wissenschaftlich zu untermauern, hat Laschet einen Expertenzirkel einberufen.
Dazu gehören der ehemalige Verfassungsrichter Udo di Fabio, der frühere Chef der Wirtschaftsweisen Christoph Schmidt und der Bonner Virologe Hendrik Streeck.
Sie halten Lockerungen für durchaus möglich.
Laschets Wort hat Gewicht, er führt mit Nordrhein-Westfalen das bevölkerungsreichste Bundesland.
Er wird am Mittwoch auf ein Signal der Mäßigung drängen.
Söder: Vom Jäger zum Gejagten
Aber nicht alle wollen Laschets Fahrplan in die Normalität unterstützen.
Der wichtigste Gegner bei schnellen Lockerungen ist der bayerische Ministerpräsident Markus Söder.
Er ist im Laufe der Pandemie vom Jäger zum Gejagten geworden: Als erste Corona-Fälle auftraten, verhängte er sofort harte Maßnahmen, ließ Schulen schließen, als andere Bundesländer noch zögerten.
Söder stieg so zu einem der beliebtesten Politiker Deutschlands auf.
Zwar beteuert der 53-Jährige seit Wochen, dass er keinerlei Ambitionen aufs Kanzleramt habe, doch immer weniger Vertreter des Führungszirkels der CDU glauben ihm das.
Laschet wirkte im Vergleich zu Söder damals wie ein lahmer Landesvater.
Doch ausgerechnet jetzt, wo sich Laschet medienwirksam als Fürsprecher der Freiheit inszeniert, zögert Söder.
Die Zahl der Infizierten geht in vielen Bundesländern deutlich zurück, aber in Bayern und Hessen ist sie nach wie vor hoch.
Einer von Söders wichtigsten Unterstützern ist deshalb Hessens CDU-Ministerpräsident Volker Bouffier.
Söder warnte kürzlich vor einem "Überbietungswettbewerb" bei den Lockerungen.
Angstvoll blicken die Länderchefs auf die Zustände in Italien und Spanien.
Niemand will ein zu großes Risiko eingehen.
Söder dürfte versuchen, jede Form von deutlichen Lockerungen abzuwenden.
Zwischen ihm und Laschet steht die Kanzlerin: Merkel moderiert die Gespräche, es ist "ein Verhandeln auf Augenhöhe", wie aus der Partei zu hören ist.
Die Kanzlerin weiß, dass sie nur mit den Ministerpräsidenten Lösungen erzielen kann, schon bei der letzten Sitzung musste sie zwischen Söder und Laschet vermitteln.
Auch die Wissenschaft ist sich nicht einig
Die Uneinigkeit liegt also an den Ministerpräsidenten selbst, an ihren Machtkämpfen und der unterschiedlichen Lage in ihren Ländern.
Aber auch die Forscher sind sich nicht immer einig.
An den harten Fakten gibt es zwar wenig zu deuteln, an der Reproduktionsrate des Virus, an der Zahl der Tests und der Zahl der Beatmungsgeräte.
Aber welche Schlüsse zieht man aus all diesen Daten?
Auf eine "schrittweise Öffnung" können sich noch alle verständigen, wie soll es auch sonst funktionieren.
Nur wie sieht der erste Schritt aus und dann der zweite und der dritte?
Diskutiert wird zunächst über die Öffnung von:
Kleineren Läden
Wichtigen Wirtschaftssektoren ohne Homeoffice-Möglichkeit
Schulen und Kitas
Restaurants
Die Reihenfolge variiert, je nachdem, wen man fragt.
Und gerade dann, wenn diese Fragen detailliert beantwortet werden sollen, herrscht keine Einigkeit.
Erst die jüngeren oder erst die älteren Schüler?
So empfahl etwa die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina am Montag, zunächst Grundschulen und die Sekundarstufe I wieder schrittweise zu öffnen – mit dem Argument, dass Jüngere stärker auf persönliche Betreuung angewiesen seien.
Das Robert Koch-Institut ist hingegen dafür, zuerst die höheren Jahrgänge wieder in die Schulen zu lassen – weil sie die Hygieneregeln besser einhalten könnten, also das Abstandhalten, das Händewaschen, das Mundschutztragen.
Thüringens Linken-Ministerpräsident Bodo Ramelow positionierte sich prompt: Die Empfehlungen der Leopoldina?
"In der Praxis wäre das unklug, weil mit den Kleinen schwerer die Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten sind", sagte er.
Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach mahnte insgesamt zur Vorsicht.
"Ich warne vor einem Schnellschuss bei den Schulen", sagte Lauterbach.
"Es besteht die große Gefahr, dass eine schnelle Öffnung der Schulen zu einer starken Verbreitung der Seuche beiträgt."
Das Problem mit den Kitas und der Mundschutz-Pflicht
Die Öffnung der Kitas ist ebenfalls ein Problem: Die Leopoldina lehnt solch eine Öffnung bis zu den Sommerferien weitgehend ab – ironischerweise genau mit dem Argument, das vom Robert Koch-Institut für die Schulen herangezogen wird: Kleinere Kinder könnten sich nicht so gut an die Distanz- und Schutzregeln halten.
Ein Regelbetrieb könne mit maximal fünf Kindern pro Raum mit denjenigen stattfinden, die bald in die Grundschule kämen.
Für alle anderen: nur im Notfall.
Die Leopoldina-Forscher schreiben selbst, dass das einiges voraussetzt: nämlich weiterhin eine "sehr flexible Handhabung von Arbeitszeiten" für die Eltern und finanzielle Unterstützung.
Eine Normalisierung für Eltern junger Kinder läge somit in weiter Ferne.
Und damit auch für ihre Arbeitgeber.
Entsprechend schnell entbrannte vehemente Kritik an diesem Punkt.
Auf die Wichtigkeit der Hygieneregeln können sich immer alle einigen.
Und zwar als Voraussetzung für jegliche Öffnung.
Doch auch da gibt es ein Problem.
"Mundschutze für alle", forderte Manuela Schwesig, die SPD-Ministerpräsidentin Mecklenburg-Vorpommerns.
Nur gibt es noch nicht einmal genug Schutzkleidung für Ärzte und Klinken.
Kann man eine Mundschutz-Pflicht erlassen, wenn man weiß, dass es nicht genügend Mundschutze gibt?
Soll man darauf bauen, dass sie im Zweifel zu Hause genäht werden – in sehr unterschiedlicher Qualität?
Die SPD-Länder wollen Zahlen
Die SPD-Länderchefs versuchen derweil, vor dem Mittwoch der Entscheidung ihre Reihen zu schließen.
Malu Dreyer, Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, sagte, sie sei sich mit ihren SPD-Kollegen einig, dass Lockerungen die Erfolge nicht gefährden dürften.
Sie müssten mit einer "Hygieneoffensive einhergehen" und sich an "Indikatoren ausrichten": der Rate der Neuansteckung, den Kapazitäten des Gesundheitssystems, der Nachverfolgung von Infizierten, ausreichend Tests und Schutzausrüstung.
Also an unbestechlichen Zahlen.
Die Indikatoren hätten mehrere Vorteile und einen Nachteil: Sie sind unabhängig überprüfbar und berücksichtigen zugleich die Verhältnisse in den einzelnen Bundesländern.
Wo die Situation schlechter ist, könnte so mit guter Begründung noch nicht so stark gelockert werden.
Und läuft es nicht wie gewünscht, kann es auch wieder in die andere Richtung gehen.
Der Nachteil: Es entstünde nicht die eine, einheitliche Regelung für ganz Deutschland.
Lassen sich die Ministerpräsidenten der Union darauf ein?
Der drängende Laschet, der zögernde Söder?
Im "Gleichschritt marschieren" – nur wohin?
Viele Politiker betonen gerade auffällig oft, dass es eine einheitliche Linie der Bundesländer brauche.
So oft, dass man vermuten muss, dass es gerade so gar nicht nach Einheitlichkeit aussieht.
Ohne gemeinsame Linie wirkten "die Regelungen sonst willkürlich und nicht nachvollziehbar", sagte SPD-Gesundheitsexperte Lauterbach.
Auch Gesundheitsminister Jens Spahn mahnte am Dienstag, ein einheitliches Vorgehen werde "für eine hohe Akzeptanz in Bevölkerung sorgen".
Doch dass "einheitlich" am Ende bedeuten wird, dass die Länder ihre Läden, Schulen und Fabriken wirklich zur gleichen Zeit wieder öffnen, erscheint fast ausgeschlossen.
Es bröckelt schon jetzt. Rainer Haseloff, CDU-Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, verschickte am Dienstag eine Stellungnahme.
Darin steht ein Satz, der in abwägender Politikersprache andeutet, wie groß die Differenzen sind.
Ein "gemeinsamer Generalkurs sollte weiterhin erkennbar bleiben", schreibt er.
Dabei könne es aber "durchaus lagebedingte, regionale und länderspezifische Unterschiede geben".
Bouffier übersetzte das in der ihm eigenen, knurrigen Art: Die Länder sollten im "Gleichschritt marschieren", sagte er.
"Aber das heißt nicht, dass sie alles gleich machen."