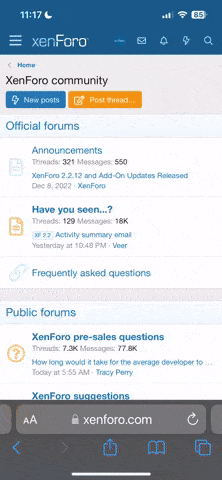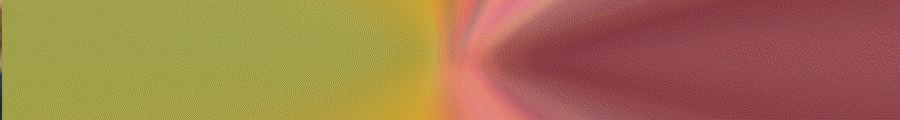collombo
MyBoerse.bz Pro Member
Neues Urhebervertragsrecht: Das ist ein Geschenk für die Gewerkschaften !
Die Bundesregierung hat den Gesetzentwurf zu einem neuen Urhebervertragsrecht beschlossen.
Die Kreativen sollen gestärkt werden.
Doch nicht nur sie profitieren.
Die Bundesregierung hat in dieser Woche einen Gesetzentwurf zur Reform des Urhebervertragsrechts beschlossen.
Ziel dieses Gesetzes ist laut Titel die verbesserte Durchsetzung des Anspruchs der Urheber auf eine angemessene Vergütung.
Der Gesetzentwurf war ein Tiger mit scharfen Zähnen, der Verwertern erhebliche Nachteile in Aussicht stellte.
Nun sind ihm die Zähne gezogen, und nur ein Reißzahn ist stehen geblieben.
Wer muss ihn fürchten, und wem hilft er?
Schon bei der Einführung des Urhebervertragsrechts in das Urheberrechtsgesetz durch die rot-grüne Koalition 2002 sollte es um die Besserstellung der Urheber gehen.
Mittel der Wahl sollten Vergütungsregeln sein, die zwischen Urhebervereinigungen und Branchenverbänden ausgehandelt werden sollten.
Vorbild war das kollektive Arbeitsrecht und die dort bewährten Branchentarifverträge.
Bis auf den heutigen Tag wurde allerdings nur ein gutes Dutzend solcher Vereinbarungen getroffen.
Manche Verfahren wurden erst vom Bundesgerichtshof entschieden, wie die Vergütungsregeln für Übersetzer.
Der neue Gesetzentwurf setzt auf diese Regelung auf und forciert die gemeinsamen Vergütungsregeln weiter.
Bedenken der Kreativwirtschaft
So soll es künftig für pauschal vergütete Urheber ein Recht der anderweitigen Verwertung geben, von dem nur aufgrund einer gemeinsamen Vergütungsregel oder eines Tarifvertrags abgewichen werden kann.
Dieser sogenannte Burdensome-Ansatz soll den mutmaßlich stärkeren Verhandlungspartner den weniger aufwendigen Lösungsweg über eine Vergütungsregel schmackhaft machen.
Zunächst war dies als ein allgemeines Rückrufsrecht ausgestaltet und galt für nahezu alle Branchen und Anwendungsbereiche.
Die überarbeitete Version nimmt untergeordnete Beiträge, Computerprogramme, Werke der Baukunst und wohl auch festangestellte Mitarbeiter aus und kommt damit den Bedenken der Wirtschaft entgegen.
Auch ein erweitertes Auskunftsrecht soll die Position der Urheber verbessern.
Sie sollen bei einer entgeltlichen Nutzung ihres Werkes einmal jährlich Auskunft und Rechenschaft über den Umfang der Nutzung ihres Werkes und der damit erzielten Umsätze verlangen können.
Dies wurde bisher auch durch die Rechtsprechung zugestanden und wird nun deutlich weiter gehend kodifiziert.
Aber auch hier wurden Bedenken der Kreativwirtschaft aufgegriffen, Ausnahmen eingefügt, und kurz vor Kabinettsbefassung wurde für mehr Rechtsklarheit gesorgt.
So viel zu den gezogenen Zähnen.
Der wichtigste Punkte der Reform ist allerdings unverändert: das Verbandsklagerecht.
Danach werden Vereinigungen, die den überwiegenden Teil der jeweiligen Urheber oder Werknutzer vertreten, ermächtigt, gemeinsame Vergütungsregeln zu erstreiten und auf deren Einhaltung zu pochen.
Das wertet Urhebervereinigungen deutlich auf.
Gegen das Interesse der Urheber können sie deren Vertragspartner auf Unterlassung verklagen.
Dies gilt aber nur für Vereinigungen, die den überwiegenden Teil der jeweiligen Urheber vertritt, wenn diese keinen gegenteiligen Beschluss fassen.
Es wird also zu erheblichen verbandspolitischen Auseinandersetzungen kommen, und große Verbände und Gewerkschaften werden zunächst bevorteilt werden.
Es gibt keine allgemeinen Lösungen
Gerade vor dem Hintergrund der Streitigkeiten zwischen Branchengewerkschaften und Einheitsgewerkschaften um die Tarifeinheit in Betrieben lässt das aufhorchen.
Der gewerkschaftliche Organisationsgrad ist im Kreativbereich, in dem es viele Tendenzbetriebe gibt, in denen das Betriebsverfassungsgesetz keine Anwendung findet, traditionell gering.
Auch das Selbstverständnis vieler Urheber als Unternehmer mag vielfach der gewerkschaftlichen Idee widersprechen.
Jedenfalls fehlt es bislang in den meisten Kreativbranchen an repräsentativen Vereinigungen.
Dies soll das Gesetz ändern, was den Urheberverbänden und Gewerkschaften neue Mitglieder bescheren könnte.
Die teils erheblichen Veränderungen zum ersten Referentenentwurf sind Ergebnis einer Läuterung und ein Zeichen von konstruktivem Umgang mit Kritik.
Das ist wichtig, denn die Kreativbranchen funktionieren höchst unterschiedlich, und es gibt keine allgemeingültigen Lösungen.
An einem Punkt ist der Entwurf kompromisslos: Das Verbandsklagerecht für Urhebervereinigungen ist unverändert.
Wenn man so will, ist das eigentliche Ziel dieser Initiative ein politisches Geschenk für die Gewerkschaften.
Sie sind auch ein guter Propeller im Kampf um Wählerstimmen bei den Kreativen.
Die Bundesregierung hat den Gesetzentwurf zu einem neuen Urhebervertragsrecht beschlossen.
Die Kreativen sollen gestärkt werden.
Doch nicht nur sie profitieren.
Die Bundesregierung hat in dieser Woche einen Gesetzentwurf zur Reform des Urhebervertragsrechts beschlossen.
Ziel dieses Gesetzes ist laut Titel die verbesserte Durchsetzung des Anspruchs der Urheber auf eine angemessene Vergütung.
Der Gesetzentwurf war ein Tiger mit scharfen Zähnen, der Verwertern erhebliche Nachteile in Aussicht stellte.
Nun sind ihm die Zähne gezogen, und nur ein Reißzahn ist stehen geblieben.
Wer muss ihn fürchten, und wem hilft er?
Schon bei der Einführung des Urhebervertragsrechts in das Urheberrechtsgesetz durch die rot-grüne Koalition 2002 sollte es um die Besserstellung der Urheber gehen.
Mittel der Wahl sollten Vergütungsregeln sein, die zwischen Urhebervereinigungen und Branchenverbänden ausgehandelt werden sollten.
Vorbild war das kollektive Arbeitsrecht und die dort bewährten Branchentarifverträge.
Bis auf den heutigen Tag wurde allerdings nur ein gutes Dutzend solcher Vereinbarungen getroffen.
Manche Verfahren wurden erst vom Bundesgerichtshof entschieden, wie die Vergütungsregeln für Übersetzer.
Der neue Gesetzentwurf setzt auf diese Regelung auf und forciert die gemeinsamen Vergütungsregeln weiter.
Bedenken der Kreativwirtschaft
So soll es künftig für pauschal vergütete Urheber ein Recht der anderweitigen Verwertung geben, von dem nur aufgrund einer gemeinsamen Vergütungsregel oder eines Tarifvertrags abgewichen werden kann.
Dieser sogenannte Burdensome-Ansatz soll den mutmaßlich stärkeren Verhandlungspartner den weniger aufwendigen Lösungsweg über eine Vergütungsregel schmackhaft machen.
Zunächst war dies als ein allgemeines Rückrufsrecht ausgestaltet und galt für nahezu alle Branchen und Anwendungsbereiche.
Die überarbeitete Version nimmt untergeordnete Beiträge, Computerprogramme, Werke der Baukunst und wohl auch festangestellte Mitarbeiter aus und kommt damit den Bedenken der Wirtschaft entgegen.
Auch ein erweitertes Auskunftsrecht soll die Position der Urheber verbessern.
Sie sollen bei einer entgeltlichen Nutzung ihres Werkes einmal jährlich Auskunft und Rechenschaft über den Umfang der Nutzung ihres Werkes und der damit erzielten Umsätze verlangen können.
Dies wurde bisher auch durch die Rechtsprechung zugestanden und wird nun deutlich weiter gehend kodifiziert.
Aber auch hier wurden Bedenken der Kreativwirtschaft aufgegriffen, Ausnahmen eingefügt, und kurz vor Kabinettsbefassung wurde für mehr Rechtsklarheit gesorgt.
So viel zu den gezogenen Zähnen.
Der wichtigste Punkte der Reform ist allerdings unverändert: das Verbandsklagerecht.
Danach werden Vereinigungen, die den überwiegenden Teil der jeweiligen Urheber oder Werknutzer vertreten, ermächtigt, gemeinsame Vergütungsregeln zu erstreiten und auf deren Einhaltung zu pochen.
Das wertet Urhebervereinigungen deutlich auf.
Gegen das Interesse der Urheber können sie deren Vertragspartner auf Unterlassung verklagen.
Dies gilt aber nur für Vereinigungen, die den überwiegenden Teil der jeweiligen Urheber vertritt, wenn diese keinen gegenteiligen Beschluss fassen.
Es wird also zu erheblichen verbandspolitischen Auseinandersetzungen kommen, und große Verbände und Gewerkschaften werden zunächst bevorteilt werden.
Es gibt keine allgemeinen Lösungen
Gerade vor dem Hintergrund der Streitigkeiten zwischen Branchengewerkschaften und Einheitsgewerkschaften um die Tarifeinheit in Betrieben lässt das aufhorchen.
Der gewerkschaftliche Organisationsgrad ist im Kreativbereich, in dem es viele Tendenzbetriebe gibt, in denen das Betriebsverfassungsgesetz keine Anwendung findet, traditionell gering.
Auch das Selbstverständnis vieler Urheber als Unternehmer mag vielfach der gewerkschaftlichen Idee widersprechen.
Jedenfalls fehlt es bislang in den meisten Kreativbranchen an repräsentativen Vereinigungen.
Dies soll das Gesetz ändern, was den Urheberverbänden und Gewerkschaften neue Mitglieder bescheren könnte.
Die teils erheblichen Veränderungen zum ersten Referentenentwurf sind Ergebnis einer Läuterung und ein Zeichen von konstruktivem Umgang mit Kritik.
Das ist wichtig, denn die Kreativbranchen funktionieren höchst unterschiedlich, und es gibt keine allgemeingültigen Lösungen.
An einem Punkt ist der Entwurf kompromisslos: Das Verbandsklagerecht für Urhebervereinigungen ist unverändert.
Wenn man so will, ist das eigentliche Ziel dieser Initiative ein politisches Geschenk für die Gewerkschaften.
Sie sind auch ein guter Propeller im Kampf um Wählerstimmen bei den Kreativen.