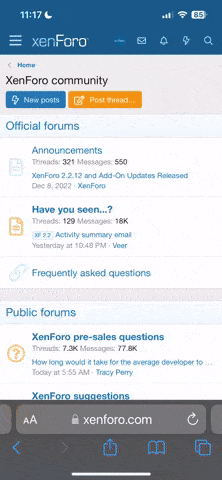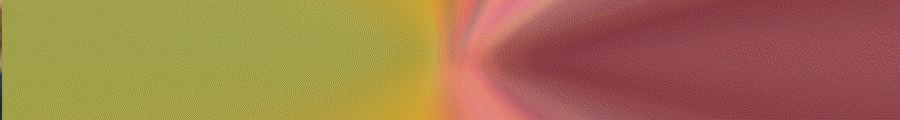collombo
MyBoerse.bz Pro Member
Termin für Bundestagswahl steht fest !
Bundespräsident bestätigt - Nächste Bundestagswahl findet am 26. September 2021 statt.
Eine Überraschung ist es nicht mehr.
Doch nun ist es offiziell: Der Bundespräsident hat die Bundestagswahl für den letzten Sonntag im September nächsten Jahres angesetzt.
Die nächste Bundestagswahl findet am 26. September 2021 statt.
Das hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier nach Angaben des Bundespräsidialamts vom Mittwoch angeordnet.
Er folgte damit einer Empfehlung der Bundesregierung.
Den Vorschlag hatte zunächst der dafür zuständige Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) gemacht.
Er hatte sich, bevor er den Termin dem Kabinett vorschlug, bereits wegen Ferienterminen mit den Ländern abgestimmt.
Das Kabinett bestätigte den Wahltermin Ende November.
Nach Paragraf 16 Bundeswahlgesetz bestimmt allerdings der Bundespräsident den Wahltag endgültig.
Er fertigte nun die Anordnung über die Bundestagswahl 2021 aus, wie dieser Vorgang offiziell heißt.
Wahltermin gibt ein zweimonatiges Zeitfenster
Das Grundgesetz sieht in Artikel 39 vor, dass der Bundestag auf vier Jahre gewählt wird.
Für die Wahltermin gibt es ein zweimonatiges Zeitfenster.
Die Neuwahl findet demnach frühestens 46 und spätestens 48 Monate nach dem Beginn der Wahlperiode statt.
Dieses Datum wird durch das Zusammentreten des neu gewählten Parlaments markiert.
Der 19. Deutsche Bundestag war am 24. September 2017 gewählt worden.
Das neu gewählte Parlament trat erstmals einen Monat später, am 24. Oktober, zusammen.
Bundespräsident bestätigt - Nächste Bundestagswahl findet am 26. September 2021 statt.
Eine Überraschung ist es nicht mehr.
Doch nun ist es offiziell: Der Bundespräsident hat die Bundestagswahl für den letzten Sonntag im September nächsten Jahres angesetzt.
Die nächste Bundestagswahl findet am 26. September 2021 statt.
Das hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier nach Angaben des Bundespräsidialamts vom Mittwoch angeordnet.
Er folgte damit einer Empfehlung der Bundesregierung.
Den Vorschlag hatte zunächst der dafür zuständige Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) gemacht.
Er hatte sich, bevor er den Termin dem Kabinett vorschlug, bereits wegen Ferienterminen mit den Ländern abgestimmt.
Das Kabinett bestätigte den Wahltermin Ende November.
Nach Paragraf 16 Bundeswahlgesetz bestimmt allerdings der Bundespräsident den Wahltag endgültig.
Er fertigte nun die Anordnung über die Bundestagswahl 2021 aus, wie dieser Vorgang offiziell heißt.
Wahltermin gibt ein zweimonatiges Zeitfenster
Das Grundgesetz sieht in Artikel 39 vor, dass der Bundestag auf vier Jahre gewählt wird.
Für die Wahltermin gibt es ein zweimonatiges Zeitfenster.
Die Neuwahl findet demnach frühestens 46 und spätestens 48 Monate nach dem Beginn der Wahlperiode statt.
Dieses Datum wird durch das Zusammentreten des neu gewählten Parlaments markiert.
Der 19. Deutsche Bundestag war am 24. September 2017 gewählt worden.
Das neu gewählte Parlament trat erstmals einen Monat später, am 24. Oktober, zusammen.