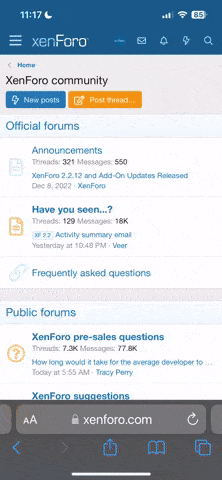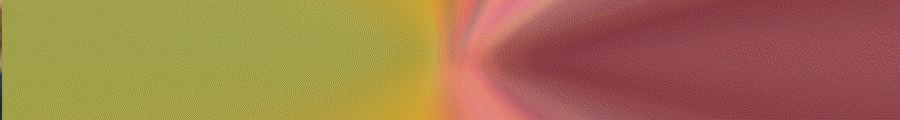collombo
MyBoerse.bz Pro Member
Nawalny muss für Jahre ins Straflager !
Gericht lehnt Berufung gegen Haftstrafe von Nawalny ab.
Vor zwei Wochen war eine Bewährungsstrafe gegen den Kreml-Kritiker Nawalny in eine Haftstrafe umgewandelt worden.
Nun lehnte ein Gericht die Berufung gegen das Urteil ab.
Ein weiteres Urteil soll am Samstag folgen.
Der Kremlgegner Alexej Nawalny muss eine mehrjährige Haftstrafe im Straflager antreten.
Seine Anwälte scheiterten am Samstag vor einem Gericht in Moskau mit dem Versuch, ein zu Monatsbeginn verhängtes Urteil aufzuheben.
Er gebe der Beschwerde nicht statt, sagte der Richter.
Das Urteil von dreieinhalb Jahren Straflager bleibt damit bestehen.
Die tatsächliche Haftzeit dürfte aber kürzer ausfallen, weil Nawalnys Anwälte davon ausgehen, dass ihm ein mehrmonatiger Hausarrest und frühere Haftzeiten angerechnet werden.
Sein Team hatte den Prozess als politisch motiviert kritisiert.
Nawalny nahm den Richterspruch gelassen auf.
Auf Videoaufnahmen war zu sehen, wie er lachte.
Ihm wird zur Last gelegt, gegen Bewährungsauflagen in einem früheren Strafverfahren verstoßen zu haben, während er sich in Deutschland von einem Anschlag mit dem Nervengift Nowitschok erholte.
Das Urteil hatte auch international für heftige Kritik gesorgt.
Nawalny bezeichnete den Vorwurf, er habe sich vor der Justiz verstecken wollen, am Samstag einmal mehr als "absurd".
Er sei Ende Januar freiwillig nach Russland zurückgekehrt.
"Die ganze Welt wusste, wo ich mich aufhalte."
Nawalny war bei seiner Rückkehr nach Moskau noch am Flughafen festgenommen worden und sitzt seither hinter Gittern.
Nach einem Bericht der staatlichen Nachrichtenagentur Nowosti könnte er schon kommende Woche in ein Straflager gebracht werden.
Ein genauer Tag wurde zunächst nicht genannt.
Gerichtshof für Menschenrechte fordert Freilassung
Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte forderte Russland erst am Mittwoch auf, Nawalny unverzüglich aus der Haft zu entlassen.
Das Urteil in diesem früheren Verfahren hatte das Menschenrechtsgericht 2017 als offenkundig unangemessen bezeichnet.
Moskau wies die Forderung als Einmischung in innere Angelegenheiten zurück.
Indes will die Menschenrechtsorganisation Amnesty International eine Petition zur Freilassung Nawalnys an den Kreml überreichen.
Dazu seien in mehreren Ländern der Welt fast 200.000 Unterschriften gesammelt worden, hieß es.
Nawalny werde wegen friedlicher politischer Aktivitäten im Kampf gegen Korruption verfolgt und weil er sein Recht auf freie Meinungsäußerung durchsetze.
Nächstes Urteil folgt noch am Samstag
Nur zwei Stunden nach Bestätigung des umstrittenen Straflager-Urteils wurde am Samstag ein zweites Verfahren gegen Nawalny fortgesetzt.
Ihm droht wegen Beleidigung eines Weltkriegsveteranen eine hohe Geldstrafe.
Die Verhandlung fand im selben Gerichtsgebäude statt wie das Berufungsverfahren am Vormittag.
Sogar die Staatsanwältin sei dieselbe, schrieb Nawalnys Team – halb amüsiert, halb entrüstet – auf Twitter.
"Bald teilen sie ihm einen persönlichen Richter und persönliche Polizisten zu."
Hintergrund des Prozesses ist Nawalnys Kritik an einem Video, das im vergangenen Sommer in den russischen Staatsmedien ausgestrahlt wurde.
Darin werben mehrere Bürger – unter anderem ein heute 94-jähriger Veteran des Zweiten Weltkrieges – für eine Verfassungsänderung, die auch der Machtsicherung von Präsident Wladimir Putin diente.
Nawalny beschimpfte die Protagonisten damals auf Twitter als "Verräter".
Der alte Mann soll sich von den Äußerungen so sehr beleidigt gefühlt haben, dass sich sein Gesundheitszustand verschlechtert habe.
Nawalny hingegen bezeichnet den Veteranen als "Marionette" in einem politisch motivierten Prozess.
Der Oppositionsführer war am 20. August während eines Inlandflugs zusammengebrochen.
Er kam zunächst in ein Krankenhaus in Sibirien.
Zwei Tage später wurde er zur Behandlung nach Berlin geflogen.
Untersuchungen mehrerer Labore zufolge wurde er mit dem Kampfstoff Nowitschok vergiftet.
Russland hingegen sieht keine Hinweise auf eine Vergiftung und deshalb keinen Grund für Ermittlungen.
Gericht lehnt Berufung gegen Haftstrafe von Nawalny ab.
Vor zwei Wochen war eine Bewährungsstrafe gegen den Kreml-Kritiker Nawalny in eine Haftstrafe umgewandelt worden.
Nun lehnte ein Gericht die Berufung gegen das Urteil ab.
Ein weiteres Urteil soll am Samstag folgen.
Der Kremlgegner Alexej Nawalny muss eine mehrjährige Haftstrafe im Straflager antreten.
Seine Anwälte scheiterten am Samstag vor einem Gericht in Moskau mit dem Versuch, ein zu Monatsbeginn verhängtes Urteil aufzuheben.
Er gebe der Beschwerde nicht statt, sagte der Richter.
Das Urteil von dreieinhalb Jahren Straflager bleibt damit bestehen.
Die tatsächliche Haftzeit dürfte aber kürzer ausfallen, weil Nawalnys Anwälte davon ausgehen, dass ihm ein mehrmonatiger Hausarrest und frühere Haftzeiten angerechnet werden.
Sein Team hatte den Prozess als politisch motiviert kritisiert.
Nawalny nahm den Richterspruch gelassen auf.
Auf Videoaufnahmen war zu sehen, wie er lachte.
Ihm wird zur Last gelegt, gegen Bewährungsauflagen in einem früheren Strafverfahren verstoßen zu haben, während er sich in Deutschland von einem Anschlag mit dem Nervengift Nowitschok erholte.
Das Urteil hatte auch international für heftige Kritik gesorgt.
Nawalny bezeichnete den Vorwurf, er habe sich vor der Justiz verstecken wollen, am Samstag einmal mehr als "absurd".
Er sei Ende Januar freiwillig nach Russland zurückgekehrt.
"Die ganze Welt wusste, wo ich mich aufhalte."
Nawalny war bei seiner Rückkehr nach Moskau noch am Flughafen festgenommen worden und sitzt seither hinter Gittern.
Nach einem Bericht der staatlichen Nachrichtenagentur Nowosti könnte er schon kommende Woche in ein Straflager gebracht werden.
Ein genauer Tag wurde zunächst nicht genannt.
Gerichtshof für Menschenrechte fordert Freilassung
Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte forderte Russland erst am Mittwoch auf, Nawalny unverzüglich aus der Haft zu entlassen.
Das Urteil in diesem früheren Verfahren hatte das Menschenrechtsgericht 2017 als offenkundig unangemessen bezeichnet.
Moskau wies die Forderung als Einmischung in innere Angelegenheiten zurück.
Indes will die Menschenrechtsorganisation Amnesty International eine Petition zur Freilassung Nawalnys an den Kreml überreichen.
Dazu seien in mehreren Ländern der Welt fast 200.000 Unterschriften gesammelt worden, hieß es.
Nawalny werde wegen friedlicher politischer Aktivitäten im Kampf gegen Korruption verfolgt und weil er sein Recht auf freie Meinungsäußerung durchsetze.
Nächstes Urteil folgt noch am Samstag
Nur zwei Stunden nach Bestätigung des umstrittenen Straflager-Urteils wurde am Samstag ein zweites Verfahren gegen Nawalny fortgesetzt.
Ihm droht wegen Beleidigung eines Weltkriegsveteranen eine hohe Geldstrafe.
Die Verhandlung fand im selben Gerichtsgebäude statt wie das Berufungsverfahren am Vormittag.
Sogar die Staatsanwältin sei dieselbe, schrieb Nawalnys Team – halb amüsiert, halb entrüstet – auf Twitter.
"Bald teilen sie ihm einen persönlichen Richter und persönliche Polizisten zu."
Hintergrund des Prozesses ist Nawalnys Kritik an einem Video, das im vergangenen Sommer in den russischen Staatsmedien ausgestrahlt wurde.
Darin werben mehrere Bürger – unter anderem ein heute 94-jähriger Veteran des Zweiten Weltkrieges – für eine Verfassungsänderung, die auch der Machtsicherung von Präsident Wladimir Putin diente.
Nawalny beschimpfte die Protagonisten damals auf Twitter als "Verräter".
Der alte Mann soll sich von den Äußerungen so sehr beleidigt gefühlt haben, dass sich sein Gesundheitszustand verschlechtert habe.
Nawalny hingegen bezeichnet den Veteranen als "Marionette" in einem politisch motivierten Prozess.
Der Oppositionsführer war am 20. August während eines Inlandflugs zusammengebrochen.
Er kam zunächst in ein Krankenhaus in Sibirien.
Zwei Tage später wurde er zur Behandlung nach Berlin geflogen.
Untersuchungen mehrerer Labore zufolge wurde er mit dem Kampfstoff Nowitschok vergiftet.
Russland hingegen sieht keine Hinweise auf eine Vergiftung und deshalb keinen Grund für Ermittlungen.