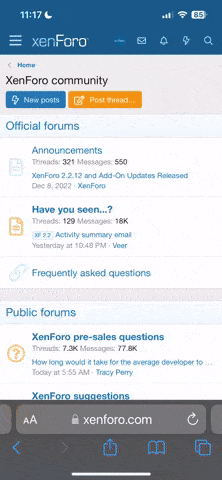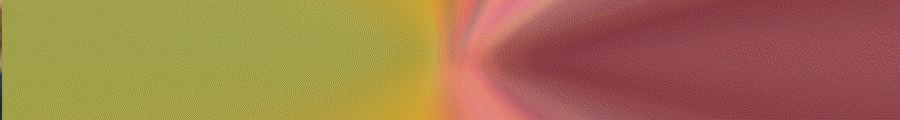collombo
MyBoerse.bz Pro Member
309. Verhandlungstag: Eine Angeklagte, die nur wenige Fragen beantwortet !
Beate Zschäpe sitzt seit Jahren in Untersuchungshaft.
Neben der laufenden Gerichtsverhandlung beschäftigt sich die Hauptangeklagte mit dem Verfassen von Briefen.
Doch das Briefgeheimnis von Gefangenen ist eingeschränkt.
Dürfen deshalb die von Zschäpe persönlich verfassten Zeilen in einem Antrag der Nebenklage öffentlich verlesen werden?
Niemand hat es gerne, wenn unbefugte Dritte Briefe lesen.
Das Briefgeheimnis ist ein in demokratischen Staaten garantiertes Grundrecht.
Für Gefangene gelten andere Regeln.
Schreiben an Volksvertretungen des Bundes und der Länder oder beispielsweise an den Europäischen Gerichtshof dürfen grundsätzlich nicht überwacht werden.
Anders ist das bei anderen Adressaten und Absendern, wenn die Sicherheit oder Ordnung der Justizvollzugsanstalt es erfordert oder aus Gründen der Behandlung.
Das Gesetz sieht aber nicht nur vor, dass die Briefe von und an Gefangene gelesen werden, sondern die Post kann sogar aus dem Verkehr gezogen werden.
Dafür müssen allerdings gewichtige Gründe vorliegen, zum Beispiel, wenn der Brief grobe Beleidigungen beinhalten würde oder wenn die Anstaltsverhältnisse „erheblich entstellend“ dargestellt wären.
Im konkreten Fall wurde ein Schreiben von Beate Zschäpe „angehalten“.
Er war adressiert an den damals noch inhaftierten Robin S.. Er zählt zum militanten Kern der rechten Szene in Dortmund.
Zschäpes Zeilen wurden ihm aber nie zugestellt, sondern in Kopie an die Strafverfolgungsbehörden weitergeleitet.
„Das ist eine Straftat!“ meinte Zschäpes Altverteidiger Wolfgang Stahl.
Der Brief ist mittlerweile Teil der Prozessakten und für die Nebenklage ein gefundenes Fressen.
Rechtsanwalt Alexander Hoffmann hatte heute gerade begonnen seinen Beweisantrag vorzutragen, als er sogleich von der Verteidigerbank unterbrochen wurde.
Der Grund: Der Nebenklagevertreter hatte angesetzt, den persönlichen Brief von Beate Zschäpe zu verlesen.
Auf der Zuschauertribüne waren Sätze zu vernehmen wie: “In guter Regelmäßigkeit wird mir hier eine Dauermedikation angeboten.
Lustig ist, dass ich keinerlei Anzeichen dafür habe.
Keine Depressionen, keinen Nervenzusammenbruch.
Das würde ich der Öffentlichkeit auch nicht zeigen.“
Einleitend hatte Hoffmann die Verlesung damit begründet, dass das Geschriebene im Gegensatz zu dem Bild stünde, das Zschäpe in der Öffentlichkeit zeichnen wolle.
Die im Gerichtssaal herrschende Öffentlichkeit wurde aufgelöst.
Journalisten und Besucher mussten vor dem Gerichtssaal zu warten.
Denn der Senat hatte beschlossen unter Ausschluss der Öffentlichkeit zu verhandeln, ob die Öffentlichkeit bei der weiteren Verlesung des Beweisantrages ausgeschlossen werden soll.
Wie der Senat entscheidet, steht noch aus.
Der Beweisantrag der Nebenkläger konnte heute jedenfalls nicht zu Ende gestellt werden.
Der Rest des Briefes blieb somit unter Verschluss.
Nach einem solchen Verhandlungstag stellen sich natürlich viele Fragen: Wie viel Privatsphäre muss einer Gefangenen zugestanden werden?
Muss Beate Zschäpe nicht selbst davon ausgehen, dass ihre Post zumindest gelesen, wenn nicht sogar gestoppt wird?
Noch dazu, wenn sie an einen anderen Gefangenen der rechten Szene adressiert ist?
Darf eine Justizvollzugsanstalt Briefe überhaupt „anhalten“ und anschließend kopieren und weiterversenden?
Geht das nicht zu weit?
Fest steht: Der Brief ist von großem Interesse – für die Prozessbeteiligten, weil er offenbar Details zum Innenleben der Angeklagten preisgibt, die so noch nicht bekannt sind.
Dem Senat liegt das Schreiben natürlich vor.
Doch so lange es nicht in den Prozess eingeführt wird, darf es beim Urteil keine Rolle spielen.
Es bleibt also spannend, welche Begründung sich das Gericht zu Eigen machen wird.
Beate Zschäpe sitzt seit Jahren in Untersuchungshaft.
Neben der laufenden Gerichtsverhandlung beschäftigt sich die Hauptangeklagte mit dem Verfassen von Briefen.
Doch das Briefgeheimnis von Gefangenen ist eingeschränkt.
Dürfen deshalb die von Zschäpe persönlich verfassten Zeilen in einem Antrag der Nebenklage öffentlich verlesen werden?
Niemand hat es gerne, wenn unbefugte Dritte Briefe lesen.
Das Briefgeheimnis ist ein in demokratischen Staaten garantiertes Grundrecht.
Für Gefangene gelten andere Regeln.
Schreiben an Volksvertretungen des Bundes und der Länder oder beispielsweise an den Europäischen Gerichtshof dürfen grundsätzlich nicht überwacht werden.
Anders ist das bei anderen Adressaten und Absendern, wenn die Sicherheit oder Ordnung der Justizvollzugsanstalt es erfordert oder aus Gründen der Behandlung.
Das Gesetz sieht aber nicht nur vor, dass die Briefe von und an Gefangene gelesen werden, sondern die Post kann sogar aus dem Verkehr gezogen werden.
Dafür müssen allerdings gewichtige Gründe vorliegen, zum Beispiel, wenn der Brief grobe Beleidigungen beinhalten würde oder wenn die Anstaltsverhältnisse „erheblich entstellend“ dargestellt wären.
Im konkreten Fall wurde ein Schreiben von Beate Zschäpe „angehalten“.
Er war adressiert an den damals noch inhaftierten Robin S.. Er zählt zum militanten Kern der rechten Szene in Dortmund.
Zschäpes Zeilen wurden ihm aber nie zugestellt, sondern in Kopie an die Strafverfolgungsbehörden weitergeleitet.
„Das ist eine Straftat!“ meinte Zschäpes Altverteidiger Wolfgang Stahl.
Der Brief ist mittlerweile Teil der Prozessakten und für die Nebenklage ein gefundenes Fressen.
Rechtsanwalt Alexander Hoffmann hatte heute gerade begonnen seinen Beweisantrag vorzutragen, als er sogleich von der Verteidigerbank unterbrochen wurde.
Der Grund: Der Nebenklagevertreter hatte angesetzt, den persönlichen Brief von Beate Zschäpe zu verlesen.
Auf der Zuschauertribüne waren Sätze zu vernehmen wie: “In guter Regelmäßigkeit wird mir hier eine Dauermedikation angeboten.
Lustig ist, dass ich keinerlei Anzeichen dafür habe.
Keine Depressionen, keinen Nervenzusammenbruch.
Das würde ich der Öffentlichkeit auch nicht zeigen.“
Einleitend hatte Hoffmann die Verlesung damit begründet, dass das Geschriebene im Gegensatz zu dem Bild stünde, das Zschäpe in der Öffentlichkeit zeichnen wolle.
Die im Gerichtssaal herrschende Öffentlichkeit wurde aufgelöst.
Journalisten und Besucher mussten vor dem Gerichtssaal zu warten.
Denn der Senat hatte beschlossen unter Ausschluss der Öffentlichkeit zu verhandeln, ob die Öffentlichkeit bei der weiteren Verlesung des Beweisantrages ausgeschlossen werden soll.
Wie der Senat entscheidet, steht noch aus.
Der Beweisantrag der Nebenkläger konnte heute jedenfalls nicht zu Ende gestellt werden.
Der Rest des Briefes blieb somit unter Verschluss.
Nach einem solchen Verhandlungstag stellen sich natürlich viele Fragen: Wie viel Privatsphäre muss einer Gefangenen zugestanden werden?
Muss Beate Zschäpe nicht selbst davon ausgehen, dass ihre Post zumindest gelesen, wenn nicht sogar gestoppt wird?
Noch dazu, wenn sie an einen anderen Gefangenen der rechten Szene adressiert ist?
Darf eine Justizvollzugsanstalt Briefe überhaupt „anhalten“ und anschließend kopieren und weiterversenden?
Geht das nicht zu weit?
Fest steht: Der Brief ist von großem Interesse – für die Prozessbeteiligten, weil er offenbar Details zum Innenleben der Angeklagten preisgibt, die so noch nicht bekannt sind.
Dem Senat liegt das Schreiben natürlich vor.
Doch so lange es nicht in den Prozess eingeführt wird, darf es beim Urteil keine Rolle spielen.
Es bleibt also spannend, welche Begründung sich das Gericht zu Eigen machen wird.