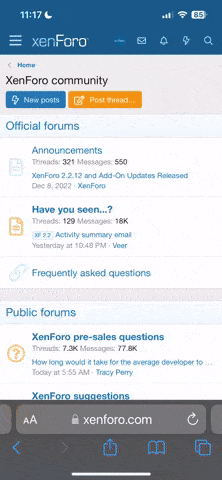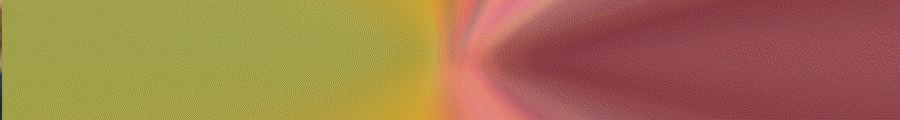collombo
MyBoerse.bz Pro Member
BGH entscheidet: Flugpreis darf nicht nur bei günstigster Zahlungsart gelten !
Transparenz beim Flugpreis: Eine Servicepauschale bei der Flugbuchung, die allen Kunden draufgeschlagen, nur Kunden mit einer bestimmten Kreditkarte erlassen wird, muss laut BGH sofort in den Gesamtpreis miteingerechnet sein.
Das geht aus einem Urteil des Bundesgerichtshofs (BGH) hervor, das am Donnerstag in Karlsruhe veröffentlicht wurde.
Der Bundesverband der Verbraucherzentralen hatte das Internet-Reiseportal Opodo verklagt. (Az. I ZR 160/15)
Kein effektiver Preisvergleich
Dort wurden bei der Suche nach Flügen mit einem bestimmten Ziel zunächst Preise angezeigt, die nur beim Bezahlen mit einer Karte von American Express galten.
Für alle anderen Kunden fiel ein zusätzliches Entgelt und eine Servicegebühr an.
Diese Kosten wurden allerdings erst sichtbar, wenn man die Voreinstellung geändert und die Preise neu berechnet hatte.
Nach Auffassung der BGH-Richter ist damit "ein effektiver Preisvergleich nicht möglich".
EU-Recht regelt das
Nach EU-Recht muss der Preis alle Steuern, Gebühren, Zuschläge und Entgelte beinhalten, "die unvermeidbar und zum Zeitpunkt der Veröffentlichung vorhersehbar sind".
Laut BGH sind Entgelte nicht nur unvermeidbar, wenn jeder sie bezahlen muss - "sondern grundsätzlich bereits dann, wenn nicht jeder Kunde sie vermeiden kann".
Welche Währung gilt?
Die Karlsruher Richter beschäftigten sich am Donnerstag auch mit der Frage, in welcher Währung der Flugpreis beispielsweise beim Buchen im Internet auszuweisen ist (Az. I ZR 209/15).
In diesem Fall hatte ein Kunde in Deutschland bei Germanwings einen Flug von London nach Stuttgart gebucht.
Auf der Internet-Seite und später in der Rechnung stand der Preis dafür nicht in Euro, sondern nur in britischen Pfund.
Die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg will mit ihrer Klage erzwingen, dass Germanwings alle Preise in Euro angibt.
Nach der Verhandlung schien aber zumindest fraglich, ob die Richter zu dem Schluss kommen, dass die maßgebliche EU-Verordnung so zu verstehen ist.
Der Senat gab auch zu bedenken, dass ein Kunde, der von London aus fliegen will, die Angebote doch sogar besser vergleichen kann, wenn alle Preise einheitlich in Pfund angegeben sind.
Das Urteil soll am 27. April verkündet werden.
Möglich ist auch, dass die Frage dann dem Europäischen Gerichtshof vorgelegt wird.
Transparenz beim Flugpreis: Eine Servicepauschale bei der Flugbuchung, die allen Kunden draufgeschlagen, nur Kunden mit einer bestimmten Kreditkarte erlassen wird, muss laut BGH sofort in den Gesamtpreis miteingerechnet sein.
Das geht aus einem Urteil des Bundesgerichtshofs (BGH) hervor, das am Donnerstag in Karlsruhe veröffentlicht wurde.
Der Bundesverband der Verbraucherzentralen hatte das Internet-Reiseportal Opodo verklagt. (Az. I ZR 160/15)
Kein effektiver Preisvergleich
Dort wurden bei der Suche nach Flügen mit einem bestimmten Ziel zunächst Preise angezeigt, die nur beim Bezahlen mit einer Karte von American Express galten.
Für alle anderen Kunden fiel ein zusätzliches Entgelt und eine Servicegebühr an.
Diese Kosten wurden allerdings erst sichtbar, wenn man die Voreinstellung geändert und die Preise neu berechnet hatte.
Nach Auffassung der BGH-Richter ist damit "ein effektiver Preisvergleich nicht möglich".
EU-Recht regelt das
Nach EU-Recht muss der Preis alle Steuern, Gebühren, Zuschläge und Entgelte beinhalten, "die unvermeidbar und zum Zeitpunkt der Veröffentlichung vorhersehbar sind".
Laut BGH sind Entgelte nicht nur unvermeidbar, wenn jeder sie bezahlen muss - "sondern grundsätzlich bereits dann, wenn nicht jeder Kunde sie vermeiden kann".
Welche Währung gilt?
Die Karlsruher Richter beschäftigten sich am Donnerstag auch mit der Frage, in welcher Währung der Flugpreis beispielsweise beim Buchen im Internet auszuweisen ist (Az. I ZR 209/15).
In diesem Fall hatte ein Kunde in Deutschland bei Germanwings einen Flug von London nach Stuttgart gebucht.
Auf der Internet-Seite und später in der Rechnung stand der Preis dafür nicht in Euro, sondern nur in britischen Pfund.
Die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg will mit ihrer Klage erzwingen, dass Germanwings alle Preise in Euro angibt.
Nach der Verhandlung schien aber zumindest fraglich, ob die Richter zu dem Schluss kommen, dass die maßgebliche EU-Verordnung so zu verstehen ist.
Der Senat gab auch zu bedenken, dass ein Kunde, der von London aus fliegen will, die Angebote doch sogar besser vergleichen kann, wenn alle Preise einheitlich in Pfund angegeben sind.
Das Urteil soll am 27. April verkündet werden.
Möglich ist auch, dass die Frage dann dem Europäischen Gerichtshof vorgelegt wird.