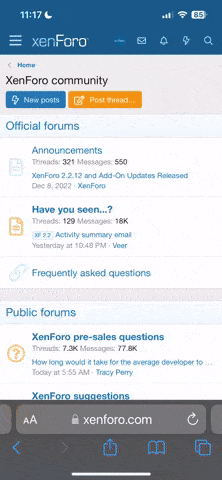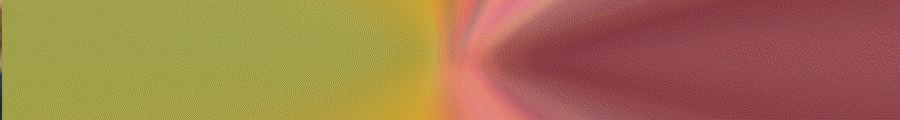collombo
MyBoerse.bz Pro Member
Merz warnt vor Überbietungswettbewerb bei Flüchtlingsaufnahme !
Der Deutsche Städtetag hat die Bundesregierung zu einer "mutigen Entscheidung" über die Aufnahme von Flüchtlingen aus Moria aufgefordert.
Friedrich Merz kritisiert derweil Forderungen nach einer europäischen Lösung.
In der Bundesregierung laufen Gespräche über die Aufnahme weiterer Schutzsuchender aus dem durch Feuer zerstörten Flüchtlingslager Moria.
Kanzlerin Angela Merkel (CDU) will eine Entscheidung bis zur Kabinettssitzung am Mittwoch.
Die Bundesregierung strebe weiterhin eine europäische Lösung an.
Das Thema dürfte auch bei den Fraktionssitzungen im Bundestag am Dienstag eine wichtige Rolle spielen.
Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD) will sich am Dienstag in Athen über die Lage in den griechischen Flüchtlingslagern informieren.
Städtetagspräsident Burkhard Jung sagte der Deutschen Presse-Agentur: "Viele deutsche Städte stehen bereit, sofort Menschen aus Moria aufzunehmen.
Es geht hier um eine akute Notlage.
Deshalb dürfen wir nicht zögern."
Der Kandidat für den CDU-Vorsitz, Friedrich Merz, sieht die Suche nach einer europäischen Lösung für die Verteilung von Flüchtlingen auf der griechischen Insel Lesbos äußerst skeptisch.
"Wenn ich es richtig sehe, hat Griechenland bisher nicht darum gebeten, Flüchtlinge aus Lesbos in der Europäischen Union aufzunehmen und auf einzelne Länder zu verteilen", sagte Merz.
Bilder von 2015 seien noch in Erinnerung
"Außer Luxemburg und Deutschland ist dazu ohnehin zum gegenwärtigen Zeitpunkt kein anderes Mitgliedsland der EU bereit.
Es macht daher weder Sinn, weiter nach einer 'europäischen Lösung' zur Verteilung zu suchen, noch in einen Überbietungswettbewerb in Deutschland einzutreten, wie viele Migranten wir denn aufnehmen sollen", so Merz weiter.
Noch seien die Bilder von 2015 in Erinnerung und auch der Satz, "dass sich diese Lage nicht wiederholen darf", sagte der frühere Unionsfraktionsvorsitzende, der sich damit erstmals zu dem Thema positionierte.
Merz argumentierte weiter, er sehe "zwei Wege zur Lösung des Problems: Wir helfen den Griechen erstens mit allen Mitteln, die wir haben, die Flüchtlinge dort menschenwürdig unterzubringen.
Dazu haben wir mit dem Roten Kreuz und dem Technischen Hilfswerk bestens ausgebildete und ausgerüstete Hilfsorganisationen."
Zudem sollte man mit Griechenland "der bereits im Europäischen Parlament diskutierten Option nähertreten, stillgelegte Kreuzfahrtschiffe für die zeitweise Unterbringung an den Außengrenzen der EU zu nutzen.
Diese Schiffe könnten dann auch zur Durchführung der Asylverfahren genutzt werden."
"Wir können nicht auf das Ergebnis warten"
Städtetagspräsident Jung, der Mitglied der SPD ist, sagte: "Deutschland sollte ein Zeichen der Soforthilfe setzen, ein Zeichen der Menschlichkeit.
Die Debatte um eine faire Verteilung von Flüchtlingen innerhalb der EU muss jedoch unbedingt weitergeführt werden.
Aber wir können nicht auf das Ergebnis warten und erst dann den obdachlos gewordenen Familien aus dem zerstörten Lager helfen.
Die Menschen aus Moria brauchen unsere Hilfe jetzt."
Innenminister Horst Seehofer (CSU) hatte am Freitag mitgeteilt, Deutschland werde von insgesamt 400 unbegleiteten Minderjährigen, die aus Griechenland in andere europäische Länder gebracht werden sollen, 100 bis 150 Jugendliche aufnehmen.
Zudem wolle man in einem zweiten Schritt mit Athen über die Aufnahme von Familien mit Kindern sprechen.
Die SPD fordert eine bundesweite Initiative für die Aufnahme von deutlich mehr Migranten aus dem abgebrannten Lager Moria als geplant.
Kühnert macht Druck
SPD-Vize-Chef und Juso-Vorsitzender Kevin Kühnert forderte Seehofer gar zum Rücktritt auf, sollte dieser seine Haltung in der Frage der Aufnahme von Flüchtlingen aus Moria nicht ändern.
Kühnert sagte der "Rheinischen Post", dass die SPD der Union "nun 48 Stunden Zeit gegeben" habe, "um sich endlich zu besinnen und zu praktikablen Vorschlägen zur Beendigung des Elends zu kommen".
Von Seehofer forderte er, dieser müsse endlich seine Blockade aufgeben und die Hilfe derer zulassen, die helfen wollten und könnten.
Griechenland will die Migranten trotz der schwierigen Situation auf Lesbos nicht zum Festland bringen oder gar gruppenweise nach Deutschland schicken – jedenfalls nicht ohne positiven Asylbescheid.
Es besteht die Furcht vor einem falschen Signal, das Migranten auch zu Brandstiftungen in anderen Lagern bewegen könnte.
Niedersachsen könne bis zu 500 Menschen aufnehmen
Das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen (UNHCR) drängt Deutschland und die EU zu raschen Taten.
Die gegenwärtigen Zustände auf Lesbos seien "eine humanitäre Notlage, die ein schnelles und unverzügliches Handeln der europäischen Staaten gemeinsam mit Griechenland erfordern", sagte der Vertreter der UN-Organisation in Deutschland, Frank Remus, den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Dienstag).
Eine gesamteuropäische Lösung sei "nach Ansicht aller Experten möglich".
Niedersachsen könnte Innenminister Boris Pistorius zufolge "relativ kurzfristig" bis zu 500 Menschen aufnehmen.
Dies habe er prüfen lassen, sagte der SPD-Politiker dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND/Dienstag) und verwies auf die Kapazitäten der Landeserstaufnahmeeinrichtungen.
Berliner Innensenator trifft sich mit Leiter des UN-Flüchtlingshilfswerks in Griechenland
Daniel Caspary, der Chef der CDU/CSU-Gruppe im Europäischen Parlament, nahm unterdessen Seehofer gegen Kritik in Schutz.
"In Griechenland leben mehr als jene 12.000 Flüchtlinge, über die wir jetzt sprechen.
Deswegen ist es wichtig, dass wir eine Lösung finden, die sich nicht nur auf die Menschen in Moria bezieht, sondern übergreifend ist", sagte er dem "Mannheimer Morgen" (Dienstag).
Berlins Innensenator Geisel reist heute nach Griechenland, um sich mit dem Leiter des UN-Flüchtlingshilfswerks UNHCR, dem deutschen Botschafter und dem Leiter der Internationalen Organisation für Migration (IOM) zu treffen.
Ob ein Termin mit dem griechischen Migrationsminister Notis Mitarakis zustande kommt, ist noch nicht sicher.
Ein Ziel der Reise sei, vor Ort auszuloten, wie Flüchtlinge aus Griechenland über ein Berliner Landesaufnahmeprogramm aufgenommen werden können, sagte ein Sprecher Geisels.
Der Deutsche Städtetag hat die Bundesregierung zu einer "mutigen Entscheidung" über die Aufnahme von Flüchtlingen aus Moria aufgefordert.
Friedrich Merz kritisiert derweil Forderungen nach einer europäischen Lösung.
In der Bundesregierung laufen Gespräche über die Aufnahme weiterer Schutzsuchender aus dem durch Feuer zerstörten Flüchtlingslager Moria.
Kanzlerin Angela Merkel (CDU) will eine Entscheidung bis zur Kabinettssitzung am Mittwoch.
Die Bundesregierung strebe weiterhin eine europäische Lösung an.
Das Thema dürfte auch bei den Fraktionssitzungen im Bundestag am Dienstag eine wichtige Rolle spielen.
Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD) will sich am Dienstag in Athen über die Lage in den griechischen Flüchtlingslagern informieren.
Städtetagspräsident Burkhard Jung sagte der Deutschen Presse-Agentur: "Viele deutsche Städte stehen bereit, sofort Menschen aus Moria aufzunehmen.
Es geht hier um eine akute Notlage.
Deshalb dürfen wir nicht zögern."
Der Kandidat für den CDU-Vorsitz, Friedrich Merz, sieht die Suche nach einer europäischen Lösung für die Verteilung von Flüchtlingen auf der griechischen Insel Lesbos äußerst skeptisch.
"Wenn ich es richtig sehe, hat Griechenland bisher nicht darum gebeten, Flüchtlinge aus Lesbos in der Europäischen Union aufzunehmen und auf einzelne Länder zu verteilen", sagte Merz.
Bilder von 2015 seien noch in Erinnerung
"Außer Luxemburg und Deutschland ist dazu ohnehin zum gegenwärtigen Zeitpunkt kein anderes Mitgliedsland der EU bereit.
Es macht daher weder Sinn, weiter nach einer 'europäischen Lösung' zur Verteilung zu suchen, noch in einen Überbietungswettbewerb in Deutschland einzutreten, wie viele Migranten wir denn aufnehmen sollen", so Merz weiter.
Noch seien die Bilder von 2015 in Erinnerung und auch der Satz, "dass sich diese Lage nicht wiederholen darf", sagte der frühere Unionsfraktionsvorsitzende, der sich damit erstmals zu dem Thema positionierte.
Merz argumentierte weiter, er sehe "zwei Wege zur Lösung des Problems: Wir helfen den Griechen erstens mit allen Mitteln, die wir haben, die Flüchtlinge dort menschenwürdig unterzubringen.
Dazu haben wir mit dem Roten Kreuz und dem Technischen Hilfswerk bestens ausgebildete und ausgerüstete Hilfsorganisationen."
Zudem sollte man mit Griechenland "der bereits im Europäischen Parlament diskutierten Option nähertreten, stillgelegte Kreuzfahrtschiffe für die zeitweise Unterbringung an den Außengrenzen der EU zu nutzen.
Diese Schiffe könnten dann auch zur Durchführung der Asylverfahren genutzt werden."
"Wir können nicht auf das Ergebnis warten"
Städtetagspräsident Jung, der Mitglied der SPD ist, sagte: "Deutschland sollte ein Zeichen der Soforthilfe setzen, ein Zeichen der Menschlichkeit.
Die Debatte um eine faire Verteilung von Flüchtlingen innerhalb der EU muss jedoch unbedingt weitergeführt werden.
Aber wir können nicht auf das Ergebnis warten und erst dann den obdachlos gewordenen Familien aus dem zerstörten Lager helfen.
Die Menschen aus Moria brauchen unsere Hilfe jetzt."
Innenminister Horst Seehofer (CSU) hatte am Freitag mitgeteilt, Deutschland werde von insgesamt 400 unbegleiteten Minderjährigen, die aus Griechenland in andere europäische Länder gebracht werden sollen, 100 bis 150 Jugendliche aufnehmen.
Zudem wolle man in einem zweiten Schritt mit Athen über die Aufnahme von Familien mit Kindern sprechen.
Die SPD fordert eine bundesweite Initiative für die Aufnahme von deutlich mehr Migranten aus dem abgebrannten Lager Moria als geplant.
Kühnert macht Druck
SPD-Vize-Chef und Juso-Vorsitzender Kevin Kühnert forderte Seehofer gar zum Rücktritt auf, sollte dieser seine Haltung in der Frage der Aufnahme von Flüchtlingen aus Moria nicht ändern.
Kühnert sagte der "Rheinischen Post", dass die SPD der Union "nun 48 Stunden Zeit gegeben" habe, "um sich endlich zu besinnen und zu praktikablen Vorschlägen zur Beendigung des Elends zu kommen".
Von Seehofer forderte er, dieser müsse endlich seine Blockade aufgeben und die Hilfe derer zulassen, die helfen wollten und könnten.
Griechenland will die Migranten trotz der schwierigen Situation auf Lesbos nicht zum Festland bringen oder gar gruppenweise nach Deutschland schicken – jedenfalls nicht ohne positiven Asylbescheid.
Es besteht die Furcht vor einem falschen Signal, das Migranten auch zu Brandstiftungen in anderen Lagern bewegen könnte.
Niedersachsen könne bis zu 500 Menschen aufnehmen
Das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen (UNHCR) drängt Deutschland und die EU zu raschen Taten.
Die gegenwärtigen Zustände auf Lesbos seien "eine humanitäre Notlage, die ein schnelles und unverzügliches Handeln der europäischen Staaten gemeinsam mit Griechenland erfordern", sagte der Vertreter der UN-Organisation in Deutschland, Frank Remus, den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Dienstag).
Eine gesamteuropäische Lösung sei "nach Ansicht aller Experten möglich".
Niedersachsen könnte Innenminister Boris Pistorius zufolge "relativ kurzfristig" bis zu 500 Menschen aufnehmen.
Dies habe er prüfen lassen, sagte der SPD-Politiker dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND/Dienstag) und verwies auf die Kapazitäten der Landeserstaufnahmeeinrichtungen.
Berliner Innensenator trifft sich mit Leiter des UN-Flüchtlingshilfswerks in Griechenland
Daniel Caspary, der Chef der CDU/CSU-Gruppe im Europäischen Parlament, nahm unterdessen Seehofer gegen Kritik in Schutz.
"In Griechenland leben mehr als jene 12.000 Flüchtlinge, über die wir jetzt sprechen.
Deswegen ist es wichtig, dass wir eine Lösung finden, die sich nicht nur auf die Menschen in Moria bezieht, sondern übergreifend ist", sagte er dem "Mannheimer Morgen" (Dienstag).
Berlins Innensenator Geisel reist heute nach Griechenland, um sich mit dem Leiter des UN-Flüchtlingshilfswerks UNHCR, dem deutschen Botschafter und dem Leiter der Internationalen Organisation für Migration (IOM) zu treffen.
Ob ein Termin mit dem griechischen Migrationsminister Notis Mitarakis zustande kommt, ist noch nicht sicher.
Ein Ziel der Reise sei, vor Ort auszuloten, wie Flüchtlinge aus Griechenland über ein Berliner Landesaufnahmeprogramm aufgenommen werden können, sagte ein Sprecher Geisels.