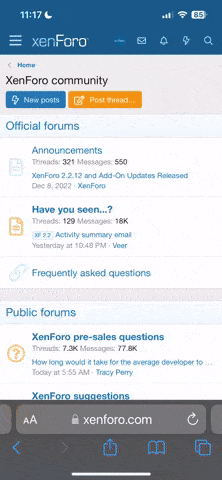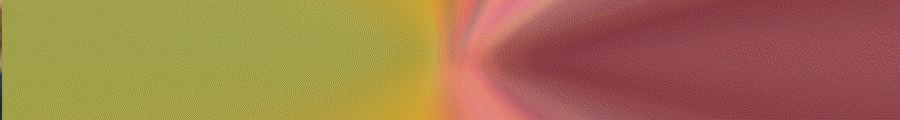collombo
MyBoerse.bz Pro Member
Der drohende flächendeckende Kita-Streik wird uns hart treffen – weil 600.000 Kinder in der Tagesbetreuung sind.
Das ist ein großer Erfolg.
Eine Bilanz von 45 Jahren Familienpolitik.
Saaagt mal, was habt ihr eigentlich in den kommenden Tagen so vor?"
Die Frage dürfte am nächsten Wochenende in dem einen oder anderen Muttertagstelefonat auftauchen.
Jedenfalls, wenn es junge Eltern sind, die ihre Mütter anrufen.
Und es ist gut möglich, dass Fleurop außergewöhnliche Umsätze verzeichnet, weil die Muttertagsgrüße in diesem Jahr üppiger ausfallen als sonst.
Es gilt, Großmütter (und Großväter) gnädig zu stimmen.
Denn in den nächsten Tagen droht ein Arbeitskampf, der vielen berufstätigen Eltern schlimmer erscheint als die Arbeitsniederlegungen bei der Bahn.
Ein Kita-Streik.
Flächendeckend.
Unbefristet.
Bis zum 5. Mai läuft die Urabstimmung der Mitglieder von GEW und Ver.di.
Danach wird es voraussichtlich noch einige Tage zum Luftholen geben – und dann machen viele Einrichtungen wohl dicht.
Oma und Opa dürften da oft die letzte Rettung sein.
"Die Streikphase wird auf jeden Fall heftig", sagt Norbert Hocke, im GEW-Vorstand zuständig für Kinder- und Jugendhilfe sowie Sozialarbeit.
Man sei zwar bisher in guten Gesprächen mit der Bundeselternvertretung, aber sicher werde man an "Grenzen der Solidarität" stoßen.
Trotzdem, sagt Hocke, es helfe nichts; der Erzieherberuf müsse endlich eine sachlich angemessene Aufwertung erfahren.
Manchem Chef junger Eltern könnte anlässlich des Streiks klar werden, dass ihre Mitarbeiter nicht nur für den Job Verantwortung tragen, sondern auch für Kinder.
Die betroffenen Mütter und Väter werden, wie in jeder Krise, individuelle Bewältigungsstrategien finden.
Doch bei aller Unbill ist der Streik auch eine Gelegenheit zur Bilanz.
Familien und Familienbilder in Deutschland haben sich innerhalb weniger Jahre dramatisch verändert – getrieben und getragen durch eine beispiellose Umbaupolitik.
1970 spielten die Kinder auf der Straße, nicht in der Kita
Vor 45 Jahren hätte sich schon deshalb kaum jemand über einen Kita-Streik aufgeregt, weil es nur wenige öffentliche Betreuungsangebote gab.
1950 existierten etwa 10.000 Einrichtungen in Westdeutschland; 1979 waren es 28.000; heute sind es bundesweit rund 55.000.
Wer durch die typischen Neubaugebiete der 60er- und 70er-Jahre streifte, der sah überall Kinder spielen, deren Mütter, Hausfrauen allesamt, gegen Abend aus den Fenstern zum Essen riefen.
Nur Andrea oder Sabine oder Frank oder Michael kamen lediglich am Wochenende dazu – als einziges Kind der einzigen "Geschiedenen" im Viertel gingen sie oder er unter der Woche in den einzigen Kindergarten weit und breit.
Das war geradezu exotisch.
Und der Begriff "Rabenmutter" wurde ohne jede Ironie verwendet.
20 Jahre später, Ende der 80er-, Anfang der 90er-Jahre, hatten sich die Dinge ein wenig, aber nicht grundlegend verändert.
Während zum Beispiel studentische Eltern heute wie selbstverständlich Krippen und Kitas auf dem Campus einfordern, während Studentenwerke und Allgemeine Studentenausschüsse Familienreferate einrichten, wurde Familiengründung zu jener Zeit noch als reine Privatsache betrachtet.
An Betreuung für unter-dreijährige Kinder zu kommen, war für Studierende wie für Berufstätige praktisch nur privat möglich.
Der nagende Rabenmutter-Gedanke hielt sich – in den Köpfen der Betroffenen wie in den Talkshows.
Dass Väter stärker in die Bewältigung des familiären Alltags eingebunden sein könnten, war bis in die 90er-Jahre ein eher unkonventioneller Gedanke.
Empirisch betrachtet neigten sie nach der Geburt des ersten Kindes zu Überstunden, was auch folgerichtig war: Die Frau war ja ohne Einkommen, die neue Familie kostete Geld.
Dass Familienpolitik weit hinter so wichtigen Politikfeldern rangierte wie Außen- oder Finanzpolitik stand außer Frage.
Noch in der ersten Regierungsperiode von Rot-Grün (1998 bis 2002) sprach Bundeskanzler Gerhard Schröder (SPD) in diesem Zusammenhang von "Gedöns".
Wenn es in den Medien um die Zukunft "der Familie" ging, dominierten pessimistische Beiträge über Zerfall, Lasten, Risiken, Geburtenrückgang.
Gleichzeitig gab es bei den jungen Frauen eine spürbare Unzufriedenheit.
So sehr die meisten von ihnen sich Kinder wünschten, so unvereinbar schien Familienglück mit beruflichem Erfolg zu sein.
Wenig Untersützung vom Partner und Arbeitgeber
Die Frauen bilanzierten nüchtern, und je mehr sie in Ausbildung und Studium investiert hatten, desto häufiger entschieden sie sich gegen Kinder.
Die Zahl der kinderlosen Akademikerinnen stieg auf 30 Prozent.
Auch das war folgerichtig: Weder vom Partner noch vom Arbeitgeber erwarteten sie die nötige Unterstützung.
Die bis dahin dominierende Familienpolitik, die sich etwa unter Heiner Geißler, Rita Süssmuth (beide CDU) oder auch Christine Bergmann (SPD) auf ein Mehr an staatlichen Geldleistungen (Kindergeld, Kinderfreibetrag, Kindererziehungszeiten in der Rentenanwartschaft, Erziehungsgeld) sowie auf Gleichstellungspolitik konzentriert hatte, fand offenbar keine Antworten auf die neuen Fragen:
Wie konnten Mütter in dem Umfang arbeiten, in dem sie es wollten – ohne ein schlechtes Gewissen zu haben?
Wie konnten junge Familien in der Zeit, in der sie es am dringendsten nötig hatten, wirksam finanziell unterstützt werden?
Welche Aufgaben hatten eigentlich die Arbeitgeber?
Wie konnte man es Paaren leichter machen, die To-do-Listen in der Familie abzuarbeiten?
Es sind im Wesentlichen die Arbeit von zwei Ministerinnen und das Ergebnis von acht Jahren beharrlicher, in die gleiche Richtung strebender Politik, die die Rahmenbedingungen für Familien in Deutschland radikal verändert haben – und mit ihnen, parallel zu ihnen, verwoben mit ihnen, die Familien.
Die mehrfache Großmutter Renate Schmidt (SPD) leitete 2002 den Paradigmenwechsel ein, in enger Zusammenarbeit mit den demoskopischen Instituten Allensbach, Infratest dimap und der Forschungsgruppe Wahlen, die in repräsentativen Umfragen ermittelten, wo es in den Familien denn tatsächlich hakte.
Mehr als 600.000 Kinder in Tagesbetreuung
Schmidt ließ sich von einer Expertenkommission unter Leitung des Berliner Soziologen Hans Bertram wissenschaftlich eng beraten.
Es ging um die Effektivität, die tatsächliche Wirksamkeit familienpolitischer Leistungen, nicht länger um ihr ideologisches Gewicht.
Zudem suchte die Ministerin die Nähe von etablierten und überzeugenden Ökonomen wie Bert Rürup und verstand es auch, Vertreter der Wirtschaft davon zu überzeugen, dass wirkungsvolle Familienpolitik ein entscheidender Faktor für Wohlstand und Wachstum sei.
Gerhard Schröder, der sich in diesen Fragen bisher harthörig gezeigt hatte, gab als erster Bundeskanzler eine familienpolitische Regierungserklärung ab.
Ursula von der Leyen (CDU) behielt von 2005 an den Kurs bei, den ihre Amtsvorgängerin eingeschlagen hatte.
Auch sie setzte auf die enge Einbindung von Demoskopie, Wissenschaft und Wirtschaft, um eine Politik zu formulieren, die wirklich vorhandene Probleme wirklich zu lösen versuchte.
Diese Beharrlichkeit bescherte sowohl der rot-grünen wie der Bundesregierung der großen Koalition (2005 bis 2009) außergewöhnlich hohe Zustimmungswerte für ihre Maßnahmen zur Familienförderung.
Obwohl die Werte unter der CDU-Familienministerin Kristina Schröder vorübergehend einbrachen, gehört das Thema heute zu den wichtigsten Anliegen der Deutschen – gleich nach der Staatsverschuldung.
Familienpolitik ist kein Nischenthema mehr.
Und die geplante "Familienarbeitszeit" deutet darauf hin, dass Manuela Schwesig (SPD) den Weg ihrer Vorgängerinnen weitergehen will.
30 Prozent der Väter gehen in Elternzeit
In den Amtszeiten Schmidt/von der Leyen wurden die Kita-Plätze massiv ausgebaut, zum einen im Elementarbereich, vor allem aber bei den Krippenkindern.
Waren 2006 noch 286.000 Kleinkinder in Tagesbetreuung, so waren es 2013 fast 600.000.
Wobei die Zahl der unter Einjährigen verschwindend gering ist: Hier signalisieren die Eltern ganz deutlich, was aus ihrer Sicht "Zu jung für Fremdbetreuung" bedeutet.
Ursula von der Leyen führte das Elterngeld als verdienstabhängige Lohnersatzleistung für ein Jahr ein.
Mit der Folge, dass deutlich mehr Mütter als zuvor nach zwölf Babymonaten wieder eine Beschäftigung aufnehmen – wie es den demoskopisch ermittelten Wünschen entspricht.
Die zunächst als "Wickelvolontariat" verspotteten "Vätermonate" (wenn beide Partner, wie auch immer aufgeteilt, Elternzeit nehmen, gibt es zwei bezahlte Monate dazu, die in der Regel vom Vater beansprucht werden) haben sich als geradezu unheimlich erfolgreich erwiesen.
Gingen 2006 gerade 3,5 Prozent der jungen Väter in Elternzeit, so sind es heute über 30 Prozent.
Das wirkt sich direkt auf die familieninterne Aufgabenteilung aus.
Nach einer Studie des Wissenschaftszentrums Berlin beschäftigen sich Männer, die Vätermonate genommen haben, im Durchschnitt eine Stunde länger am Tag mit ihren Kindern als zuvor.
Dass sie sich aktiv am Leben ihres Nachwuchses beteiligen können, ist inzwischen der Wunsch der großen Mehrheit der jungen Männer.
Die Elternzeit ebnet dafür den Weg – und signalisiert den Unternehmen, dass nicht Mutterschaft, sondern Elternschaft ein Risiko ist, mit dem sie in Zukunft leben müssen.
Was in Zeiten der Fachkräfteknappheit vielleicht allgemein leichter fällt.
Ein sprunghafter Anstieg der Geburtenrate war auch durch die konzertierte familienpolitische Aktion 2002 bis 2009 nicht zu erwarten.
Einstellungswandel vollziehen sich in Jahrzehnten.
Aber immerhin hat sich die Quote seit 2004 statistisch relevant von 1,36 auf durchschnittliche 1,41 Kinder pro Frau erhöht.
Das ist keine Lösung für unser bevorstehendes Demografieproblem – aber es ist unendlich viel besser als weiterer Schwund und Kinderabstinenz.
Natürlich bleiben auch angesichts einer so positiven Bilanz viele Fragen offen.
Nimmt man den Kindern mit der Ganztagsbetreuung nicht doch ein Stück unverplanter Kindheit, die für ihre Entwicklung vielleicht ebenso wichtig war wie "frühkindliche Bildung" in der Kita?
Wie halten Kinder und Paare den Stress aus, wenn beide Eltern in Vollzeit arbeiten?
Haben wir beim Kita-Ausbau im Hauruckverfahren genug darauf geachtet, was in den Einrichtungen den ganzen Tag geschieht?
Entspricht die Ausbildung von Erzieherinnen noch dem, was sie heute tatsächlich leisten müssen?
(Auch darum geht es bei dem anstehenden Streik.)
Gibt es nicht bis heute gewaltige Defizite bei den Ganztagsschulen?
Dürfen sich nicht all jene Frauen an der Nase herumgeführt fühlen, die der Kinder wegen auf eigene berufliche Ambitionen verzichtet haben, weil der gesellschaftliche Mainstream so klar eine andere Richtung vorzugeben schien?
Machen wir nun nicht mit bewährter deutscher Gründlichkeit den Familien das Leben schwer, die sich bewusst für ein Ein-Verdiener-Modell entscheiden wollen?
All diese Fragen bedürfen der gründlichen Erörterung.
Aber schon gibt es Bücher, die in bewegten Worten die "Alles ist möglich-Lüge" anprangern, oder sehr betroffen "Geht alles gar nicht!" rufen.
(Im letzteren Fall sind die Autoren Männer).
In diesen Büchern ist viel von Wut und Frustration die Rede, von "Vereinbarkeitslügnern" und Märchen.
Hätte der politische Paradigmenwechsel lieber unterbleiben sollen?
Deutschland hat in wenigen Jahren vom Leitbild der Hausfrau und Berufsmutter auf das Leitbild der prinzipiell berufstätigen Eltern umgeschaltet.
Vielleicht, wie immer gern bei uns, ein wenig ideologisch.
Fast sicher mit einem Hang zur Übertreibung, zur turbokapitalistischen Karikatur.
Vielleicht, nein wahrscheinlich, mit Betreuungsinfrastruktur, die manches zu wünschen übrig lässt.
Niemand hat gesagt, dass es leicht wird. Aber die real existierenden Optionen lassen heute mehr Wahlmöglichkeiten zu als vor 20 oder vor 45 Jahren.
Das ist ein Ergebnis von guter Politik.
Ein flächendeckender Kita-Streik ist ein Zeichen des Fortschritts.
Und es ist schön und in Ordnung, dass die traditionellen Großeltern darin ihren ewigen, fortschrittlichen Platz behalten.
Das ist ein großer Erfolg.
Eine Bilanz von 45 Jahren Familienpolitik.
Saaagt mal, was habt ihr eigentlich in den kommenden Tagen so vor?"
Die Frage dürfte am nächsten Wochenende in dem einen oder anderen Muttertagstelefonat auftauchen.
Jedenfalls, wenn es junge Eltern sind, die ihre Mütter anrufen.
Und es ist gut möglich, dass Fleurop außergewöhnliche Umsätze verzeichnet, weil die Muttertagsgrüße in diesem Jahr üppiger ausfallen als sonst.
Es gilt, Großmütter (und Großväter) gnädig zu stimmen.
Denn in den nächsten Tagen droht ein Arbeitskampf, der vielen berufstätigen Eltern schlimmer erscheint als die Arbeitsniederlegungen bei der Bahn.
Ein Kita-Streik.
Flächendeckend.
Unbefristet.
Bis zum 5. Mai läuft die Urabstimmung der Mitglieder von GEW und Ver.di.
Danach wird es voraussichtlich noch einige Tage zum Luftholen geben – und dann machen viele Einrichtungen wohl dicht.
Oma und Opa dürften da oft die letzte Rettung sein.
"Die Streikphase wird auf jeden Fall heftig", sagt Norbert Hocke, im GEW-Vorstand zuständig für Kinder- und Jugendhilfe sowie Sozialarbeit.
Man sei zwar bisher in guten Gesprächen mit der Bundeselternvertretung, aber sicher werde man an "Grenzen der Solidarität" stoßen.
Trotzdem, sagt Hocke, es helfe nichts; der Erzieherberuf müsse endlich eine sachlich angemessene Aufwertung erfahren.
Manchem Chef junger Eltern könnte anlässlich des Streiks klar werden, dass ihre Mitarbeiter nicht nur für den Job Verantwortung tragen, sondern auch für Kinder.
Die betroffenen Mütter und Väter werden, wie in jeder Krise, individuelle Bewältigungsstrategien finden.
Doch bei aller Unbill ist der Streik auch eine Gelegenheit zur Bilanz.
Familien und Familienbilder in Deutschland haben sich innerhalb weniger Jahre dramatisch verändert – getrieben und getragen durch eine beispiellose Umbaupolitik.
1970 spielten die Kinder auf der Straße, nicht in der Kita
Vor 45 Jahren hätte sich schon deshalb kaum jemand über einen Kita-Streik aufgeregt, weil es nur wenige öffentliche Betreuungsangebote gab.
1950 existierten etwa 10.000 Einrichtungen in Westdeutschland; 1979 waren es 28.000; heute sind es bundesweit rund 55.000.
Wer durch die typischen Neubaugebiete der 60er- und 70er-Jahre streifte, der sah überall Kinder spielen, deren Mütter, Hausfrauen allesamt, gegen Abend aus den Fenstern zum Essen riefen.
Nur Andrea oder Sabine oder Frank oder Michael kamen lediglich am Wochenende dazu – als einziges Kind der einzigen "Geschiedenen" im Viertel gingen sie oder er unter der Woche in den einzigen Kindergarten weit und breit.
Das war geradezu exotisch.
Und der Begriff "Rabenmutter" wurde ohne jede Ironie verwendet.
20 Jahre später, Ende der 80er-, Anfang der 90er-Jahre, hatten sich die Dinge ein wenig, aber nicht grundlegend verändert.
Während zum Beispiel studentische Eltern heute wie selbstverständlich Krippen und Kitas auf dem Campus einfordern, während Studentenwerke und Allgemeine Studentenausschüsse Familienreferate einrichten, wurde Familiengründung zu jener Zeit noch als reine Privatsache betrachtet.
An Betreuung für unter-dreijährige Kinder zu kommen, war für Studierende wie für Berufstätige praktisch nur privat möglich.
Der nagende Rabenmutter-Gedanke hielt sich – in den Köpfen der Betroffenen wie in den Talkshows.
Dass Väter stärker in die Bewältigung des familiären Alltags eingebunden sein könnten, war bis in die 90er-Jahre ein eher unkonventioneller Gedanke.
Empirisch betrachtet neigten sie nach der Geburt des ersten Kindes zu Überstunden, was auch folgerichtig war: Die Frau war ja ohne Einkommen, die neue Familie kostete Geld.
Dass Familienpolitik weit hinter so wichtigen Politikfeldern rangierte wie Außen- oder Finanzpolitik stand außer Frage.
Noch in der ersten Regierungsperiode von Rot-Grün (1998 bis 2002) sprach Bundeskanzler Gerhard Schröder (SPD) in diesem Zusammenhang von "Gedöns".
Wenn es in den Medien um die Zukunft "der Familie" ging, dominierten pessimistische Beiträge über Zerfall, Lasten, Risiken, Geburtenrückgang.
Gleichzeitig gab es bei den jungen Frauen eine spürbare Unzufriedenheit.
So sehr die meisten von ihnen sich Kinder wünschten, so unvereinbar schien Familienglück mit beruflichem Erfolg zu sein.
Wenig Untersützung vom Partner und Arbeitgeber
Die Frauen bilanzierten nüchtern, und je mehr sie in Ausbildung und Studium investiert hatten, desto häufiger entschieden sie sich gegen Kinder.
Die Zahl der kinderlosen Akademikerinnen stieg auf 30 Prozent.
Auch das war folgerichtig: Weder vom Partner noch vom Arbeitgeber erwarteten sie die nötige Unterstützung.
Die bis dahin dominierende Familienpolitik, die sich etwa unter Heiner Geißler, Rita Süssmuth (beide CDU) oder auch Christine Bergmann (SPD) auf ein Mehr an staatlichen Geldleistungen (Kindergeld, Kinderfreibetrag, Kindererziehungszeiten in der Rentenanwartschaft, Erziehungsgeld) sowie auf Gleichstellungspolitik konzentriert hatte, fand offenbar keine Antworten auf die neuen Fragen:
Wie konnten Mütter in dem Umfang arbeiten, in dem sie es wollten – ohne ein schlechtes Gewissen zu haben?
Wie konnten junge Familien in der Zeit, in der sie es am dringendsten nötig hatten, wirksam finanziell unterstützt werden?
Welche Aufgaben hatten eigentlich die Arbeitgeber?
Wie konnte man es Paaren leichter machen, die To-do-Listen in der Familie abzuarbeiten?
Es sind im Wesentlichen die Arbeit von zwei Ministerinnen und das Ergebnis von acht Jahren beharrlicher, in die gleiche Richtung strebender Politik, die die Rahmenbedingungen für Familien in Deutschland radikal verändert haben – und mit ihnen, parallel zu ihnen, verwoben mit ihnen, die Familien.
Die mehrfache Großmutter Renate Schmidt (SPD) leitete 2002 den Paradigmenwechsel ein, in enger Zusammenarbeit mit den demoskopischen Instituten Allensbach, Infratest dimap und der Forschungsgruppe Wahlen, die in repräsentativen Umfragen ermittelten, wo es in den Familien denn tatsächlich hakte.
Mehr als 600.000 Kinder in Tagesbetreuung
Schmidt ließ sich von einer Expertenkommission unter Leitung des Berliner Soziologen Hans Bertram wissenschaftlich eng beraten.
Es ging um die Effektivität, die tatsächliche Wirksamkeit familienpolitischer Leistungen, nicht länger um ihr ideologisches Gewicht.
Zudem suchte die Ministerin die Nähe von etablierten und überzeugenden Ökonomen wie Bert Rürup und verstand es auch, Vertreter der Wirtschaft davon zu überzeugen, dass wirkungsvolle Familienpolitik ein entscheidender Faktor für Wohlstand und Wachstum sei.
Gerhard Schröder, der sich in diesen Fragen bisher harthörig gezeigt hatte, gab als erster Bundeskanzler eine familienpolitische Regierungserklärung ab.
Ursula von der Leyen (CDU) behielt von 2005 an den Kurs bei, den ihre Amtsvorgängerin eingeschlagen hatte.
Auch sie setzte auf die enge Einbindung von Demoskopie, Wissenschaft und Wirtschaft, um eine Politik zu formulieren, die wirklich vorhandene Probleme wirklich zu lösen versuchte.
Diese Beharrlichkeit bescherte sowohl der rot-grünen wie der Bundesregierung der großen Koalition (2005 bis 2009) außergewöhnlich hohe Zustimmungswerte für ihre Maßnahmen zur Familienförderung.
Obwohl die Werte unter der CDU-Familienministerin Kristina Schröder vorübergehend einbrachen, gehört das Thema heute zu den wichtigsten Anliegen der Deutschen – gleich nach der Staatsverschuldung.
Familienpolitik ist kein Nischenthema mehr.
Und die geplante "Familienarbeitszeit" deutet darauf hin, dass Manuela Schwesig (SPD) den Weg ihrer Vorgängerinnen weitergehen will.
30 Prozent der Väter gehen in Elternzeit
In den Amtszeiten Schmidt/von der Leyen wurden die Kita-Plätze massiv ausgebaut, zum einen im Elementarbereich, vor allem aber bei den Krippenkindern.
Waren 2006 noch 286.000 Kleinkinder in Tagesbetreuung, so waren es 2013 fast 600.000.
Wobei die Zahl der unter Einjährigen verschwindend gering ist: Hier signalisieren die Eltern ganz deutlich, was aus ihrer Sicht "Zu jung für Fremdbetreuung" bedeutet.
Ursula von der Leyen führte das Elterngeld als verdienstabhängige Lohnersatzleistung für ein Jahr ein.
Mit der Folge, dass deutlich mehr Mütter als zuvor nach zwölf Babymonaten wieder eine Beschäftigung aufnehmen – wie es den demoskopisch ermittelten Wünschen entspricht.
Die zunächst als "Wickelvolontariat" verspotteten "Vätermonate" (wenn beide Partner, wie auch immer aufgeteilt, Elternzeit nehmen, gibt es zwei bezahlte Monate dazu, die in der Regel vom Vater beansprucht werden) haben sich als geradezu unheimlich erfolgreich erwiesen.
Gingen 2006 gerade 3,5 Prozent der jungen Väter in Elternzeit, so sind es heute über 30 Prozent.
Das wirkt sich direkt auf die familieninterne Aufgabenteilung aus.
Nach einer Studie des Wissenschaftszentrums Berlin beschäftigen sich Männer, die Vätermonate genommen haben, im Durchschnitt eine Stunde länger am Tag mit ihren Kindern als zuvor.
Dass sie sich aktiv am Leben ihres Nachwuchses beteiligen können, ist inzwischen der Wunsch der großen Mehrheit der jungen Männer.
Die Elternzeit ebnet dafür den Weg – und signalisiert den Unternehmen, dass nicht Mutterschaft, sondern Elternschaft ein Risiko ist, mit dem sie in Zukunft leben müssen.
Was in Zeiten der Fachkräfteknappheit vielleicht allgemein leichter fällt.
Ein sprunghafter Anstieg der Geburtenrate war auch durch die konzertierte familienpolitische Aktion 2002 bis 2009 nicht zu erwarten.
Einstellungswandel vollziehen sich in Jahrzehnten.
Aber immerhin hat sich die Quote seit 2004 statistisch relevant von 1,36 auf durchschnittliche 1,41 Kinder pro Frau erhöht.
Das ist keine Lösung für unser bevorstehendes Demografieproblem – aber es ist unendlich viel besser als weiterer Schwund und Kinderabstinenz.
Natürlich bleiben auch angesichts einer so positiven Bilanz viele Fragen offen.
Nimmt man den Kindern mit der Ganztagsbetreuung nicht doch ein Stück unverplanter Kindheit, die für ihre Entwicklung vielleicht ebenso wichtig war wie "frühkindliche Bildung" in der Kita?
Wie halten Kinder und Paare den Stress aus, wenn beide Eltern in Vollzeit arbeiten?
Haben wir beim Kita-Ausbau im Hauruckverfahren genug darauf geachtet, was in den Einrichtungen den ganzen Tag geschieht?
Entspricht die Ausbildung von Erzieherinnen noch dem, was sie heute tatsächlich leisten müssen?
(Auch darum geht es bei dem anstehenden Streik.)
Gibt es nicht bis heute gewaltige Defizite bei den Ganztagsschulen?
Dürfen sich nicht all jene Frauen an der Nase herumgeführt fühlen, die der Kinder wegen auf eigene berufliche Ambitionen verzichtet haben, weil der gesellschaftliche Mainstream so klar eine andere Richtung vorzugeben schien?
Machen wir nun nicht mit bewährter deutscher Gründlichkeit den Familien das Leben schwer, die sich bewusst für ein Ein-Verdiener-Modell entscheiden wollen?
All diese Fragen bedürfen der gründlichen Erörterung.
Aber schon gibt es Bücher, die in bewegten Worten die "Alles ist möglich-Lüge" anprangern, oder sehr betroffen "Geht alles gar nicht!" rufen.
(Im letzteren Fall sind die Autoren Männer).
In diesen Büchern ist viel von Wut und Frustration die Rede, von "Vereinbarkeitslügnern" und Märchen.
Hätte der politische Paradigmenwechsel lieber unterbleiben sollen?
Deutschland hat in wenigen Jahren vom Leitbild der Hausfrau und Berufsmutter auf das Leitbild der prinzipiell berufstätigen Eltern umgeschaltet.
Vielleicht, wie immer gern bei uns, ein wenig ideologisch.
Fast sicher mit einem Hang zur Übertreibung, zur turbokapitalistischen Karikatur.
Vielleicht, nein wahrscheinlich, mit Betreuungsinfrastruktur, die manches zu wünschen übrig lässt.
Niemand hat gesagt, dass es leicht wird. Aber die real existierenden Optionen lassen heute mehr Wahlmöglichkeiten zu als vor 20 oder vor 45 Jahren.
Das ist ein Ergebnis von guter Politik.
Ein flächendeckender Kita-Streik ist ein Zeichen des Fortschritts.
Und es ist schön und in Ordnung, dass die traditionellen Großeltern darin ihren ewigen, fortschrittlichen Platz behalten.