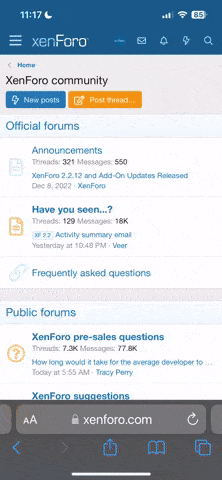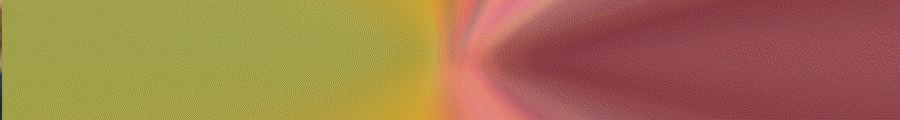collombo
MyBoerse.bz Pro Member
Urteil in Rheinland-Pfalz: Reichsbürger müssen ihre Waffen abgeben !
Wer nicht an die Gesetze in Deutschland glaubt, wird sich womöglich auch nicht an sie halten – und sollte deswegen keine Waffen haben.
Das hat ein Gericht entschieden.
Wer als Sympathisant der sogenannten Reichsbürgerbewegung die Rechtsordnung in Deutschland anzweifelt, hat kein Recht auf Waffenbesitz.
Das hat das Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz in Koblenz nun entschieden.
Anlass war ein Streitfall zwischen einem Waffenbesitzer und der Waffenbehörde eines Landkreises: Die zuständige Behörde hatte die Waffenbesitzkarten der beiden Männer widerrufen, weil sie gemäß mehrerer eigener Schreiben waffenrechtlich unzuverlässig seien.
Die Beschwerde der Männer wies das Oberverwaltungsgericht nun ab.
Das Gericht bestätigte die Ansicht der Behörde, wonach der Antragsteller seinen Waffenschein abgeben müsse.
Dies hatte das Amt an Schreiben der Antragsteller festgemacht, die sie an die Waffenbehörde geschickt hatten.
Darin zweifelten sie die Geltung der Strafprozess- und der Zivilprozessordnung, des Gerichtsverfassungsgesetzes und des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten an.
Die Bundesrepublik existiere nicht und sei vielmehr eine Nichtregierungsorganisation oder GmbH.
Anerkennung der Gesetze ist ausschlaggebend
Ausschlaggebend ist dem Urteil zufolge nicht die Sympathie eines potenziellen Waffenbesitzers mit den Reichsbürgern, die keine einheitliche und weltanschaulich homogene Bewegung darstellten.
Vielmehr geht es den Richtern grundsätzlich um die Anerkennung der Gesetzesgeltung.
Wer diese nicht als verbindlich betrachte, gebe Anlass zur Befürchtung, Vorschriften im Umgang mit Waffen und Munition nicht einzuhalten.
Die Aussage der beiden Männer, dass es mehr als 15 Jahre lang keine Gesetzesverstöße mit ihren Schusswaffen gegeben habe, war nach Meinung des Gerichts nicht von Bedeutung.
Ein Restrisiko bei der Beurteilung ihrer Zuverlässigkeit mit den Waffen müsse nicht hingenommen werden.
Nach früheren Angaben des rheinland-pfälzischen Innenministeriums in Mainz gibt es landesweit rund 550 Reichsbürger.
77 davon gelten als gewaltbereit.
Wer nicht an die Gesetze in Deutschland glaubt, wird sich womöglich auch nicht an sie halten – und sollte deswegen keine Waffen haben.
Das hat ein Gericht entschieden.
Wer als Sympathisant der sogenannten Reichsbürgerbewegung die Rechtsordnung in Deutschland anzweifelt, hat kein Recht auf Waffenbesitz.
Das hat das Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz in Koblenz nun entschieden.
Anlass war ein Streitfall zwischen einem Waffenbesitzer und der Waffenbehörde eines Landkreises: Die zuständige Behörde hatte die Waffenbesitzkarten der beiden Männer widerrufen, weil sie gemäß mehrerer eigener Schreiben waffenrechtlich unzuverlässig seien.
Die Beschwerde der Männer wies das Oberverwaltungsgericht nun ab.
Das Gericht bestätigte die Ansicht der Behörde, wonach der Antragsteller seinen Waffenschein abgeben müsse.
Dies hatte das Amt an Schreiben der Antragsteller festgemacht, die sie an die Waffenbehörde geschickt hatten.
Darin zweifelten sie die Geltung der Strafprozess- und der Zivilprozessordnung, des Gerichtsverfassungsgesetzes und des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten an.
Die Bundesrepublik existiere nicht und sei vielmehr eine Nichtregierungsorganisation oder GmbH.
Anerkennung der Gesetze ist ausschlaggebend
Ausschlaggebend ist dem Urteil zufolge nicht die Sympathie eines potenziellen Waffenbesitzers mit den Reichsbürgern, die keine einheitliche und weltanschaulich homogene Bewegung darstellten.
Vielmehr geht es den Richtern grundsätzlich um die Anerkennung der Gesetzesgeltung.
Wer diese nicht als verbindlich betrachte, gebe Anlass zur Befürchtung, Vorschriften im Umgang mit Waffen und Munition nicht einzuhalten.
Die Aussage der beiden Männer, dass es mehr als 15 Jahre lang keine Gesetzesverstöße mit ihren Schusswaffen gegeben habe, war nach Meinung des Gerichts nicht von Bedeutung.
Ein Restrisiko bei der Beurteilung ihrer Zuverlässigkeit mit den Waffen müsse nicht hingenommen werden.
Nach früheren Angaben des rheinland-pfälzischen Innenministeriums in Mainz gibt es landesweit rund 550 Reichsbürger.
77 davon gelten als gewaltbereit.