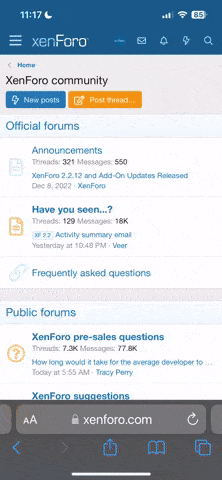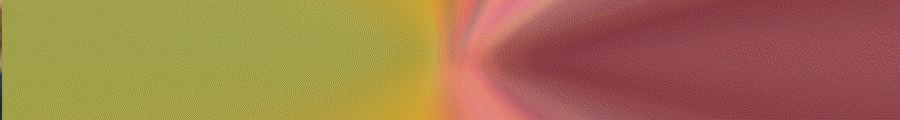fireleaf
Ruhe in Frieden

Statt nach der Schlappe bei den Zwischenwahlen zur „lame duck“ zu werden, geht US-Präsident Barack Obama in die Offensive, wie sein Alleingang bei der Einwanderungspolitik zeigt. FOCUS-Online-Experte Thomas Jäger erklärt, warum Obama nun erstmals den Polit-Rambo geben kann.
Am Tag danach, als Präsident Obama in Nevada vor Schülern deklamierte, in Fragen der Integration von irregulären Migranten nie aufgeben zu wollen, wurde überdeutlich, was seine Verordnung zur Ausführung des Einwanderungsgesetzes vor allem war: der Startschuss der Demokraten für den Präsidentschaftswahlkampf 2016.
Zwar tritt Obama nicht mehr an, aber wer ihm nachfolgt, entscheidet mit darüber, in welchem Licht seine Präsidentschaft in den nächsten Jahren gesehen wird. Deshalb ist ihm das nicht gleichgültig. Zudem sollen die eigenen Netzwerke an den Schalthebeln der Macht beteiligt bleiben. Dass er die politische Entscheidung auch inhaltlich für richtig hält, erleichterte ihm das Handeln.
Keine Rücksicht mehr
Zuletzt hatte der Präsident Zurückhaltung geübt, weil Hoffnung bestand, dass einige der demokratischen Senatoren aus dem Süden bei den Zwischenwahlen Anfang November 2014 doch noch ihren Sitz verteidigen könnten.
Dann kam die Wahlklatsche so krachend auf die Demokraten herunter, dass nunmehr sogar egal ist, ob die Nachwahl in Louisiana auch noch verloren geht. Rücksicht auf die konservativen demokratischen Wähler des Südens wollte der Präsident nicht weiter nehmen.
Taktisch brillant
So kam es zu dem Paradox, dass die Demokratische Partei die Wahlen verlor, dies aber Präsident Obama erst in die Lage versetzte, ohne weitere Überlegungen noch in Betracht zu ziehen, an seinem politischen Denkmal zu zimmern.
Eine zweite große Reform im Innern wird ihm verwehrt bleiben. Internationale Krisen scheinen ihm ein ums andere Mal zu entgleiten. Da bleibt ihm nur noch die exekutive Verwaltungskompetenz, um Politik zu prägen. Das hat er nun, taktisch brillant und mit großer juristischer Raffinesse, umgesetzt. Denn der republikanische Kongress kann den ausführenden Citizenship and Immigration Services noch nicht mal die Budgetmittel kürzen.
Die Stimmen der Hispanics sichern
Dies trifft sich glücklich mit einem Umstand, den die demokratischen Wahlkämpfer nach den Zwischenwahlen sofort gesehen haben. Sie konnten die „Obama-Wähler“ nicht mobilisieren. Insbesondere auch die hispanische Wählerschaft hatte schon in den Monaten zuvor in allen Umfragen zu erkennen gegeben, dass sie vom Präsidenten tief enttäuscht ist und deshalb nicht in großer Zahl zur Wahl gehen will.
2016 wird die Frage, ob man gerade diese Gruppe mobilisieren kann, möglicherweise über den Wahlausgang entscheiden. Da bot es sich an, die Einwanderungspolitik zum präsidentiellen Alleinstellungsmerkmal zu machen.
Wenn es eine Reform der Einwanderungspolitik in Verhandlungen mit den Republikanern geworden wäre – Zugeständnisse in Steuerfragen gegen Zugeständnisse in Einwanderungsfragen – dann wäre das zwar ein politischer Kompromiss, aber zugleich und vor allem ein Marketingfehler gewesen. Deshalb drängte die Zeit, dies jetzt zu verkünden. Und Obama landete diesen Marketing-Coup, den er sichtbar genoss.
Zerstrittene Republikaner
Die Republikaner haben Präsident Obama diese Gelegenheit gegeben. Selbst dran schuld. Deshalb dürfen sie sich nun nicht darüber beschweren, dass er sie nutzte. Das lag vor allem daran, dass sie in dieser Frage tief zerstritten sind. Deren Klärung reicht so tief, dass es mit politischer Camouflage nicht verdeckt werden kann.
Das republikanische Establishment ist von der neuen Politik gar nicht so weit weg. Sie wissen, dass auch sie die hispanischen Stimmen bei der Präsidentenwahl brauchen, weshalb Jeb Bush, dessen Frau aus Mexiko stammt, einen Startvorteil hat.
Aber viele republikanische Wähler konnten in den letzten Jahren auf diesem Weg nicht mitgenommen werden. Sie sehen das Amerika, in dem sie groß geworden sind, verschwinden. Ihnen kommt die Gewissheit ihrer Nation abhanden. Das hat einen guten Grund: Es ist nämlich so.
Das Reagan-Amerika ist nicht mehr
Die Frage, wer die Amerikaner als Nation sind, ist jedenfalls nicht mit dem Hinweis zu beantworten, dass alles so bleiben soll, wie es war. Das Reagan-Amerika ist nicht mehr. Und es wird nicht mehr so sein - und hier kommen die Republikaner in eine grundlegende Klemme. Wie stellen sie sich die amerikanische Gesellschaft der Zukunft vor?
An der Antwort auf diese Frage sind sie in den letzten Jahren gescheitert, weil sie so tief gespalten sind. Sie haben die Spaltung der demokratischen Partei aus den sechziger und siebziger Jahren geerbt. Das ist hilfreich, wenn es um Wahlstimmen geht. Es ist lästig, wenn es um die politische Orientierung geht.
Diese Lage werden nun einige Republikaner nutzen wollen, einen ähnlichen Sturm wie gegen die Gesundheitsreform zu entfachen, als sich Bürgerprotest – ja Hass – in zahlreichen Versammlungen und dann an den Wahlurnen gegen Obamacare entlud.
Diejenigen, die den Konflikt nun eskalieren wollen, die von Machtmissbrauch, Verfassungskrise und Amtsenthebung sprechen, haben dieses kühle Kalkül im Kopf. Heißsporne sind sie nur auf der Bühne.
Der Präsident kalkuliert ebenso kühl
Genauso kühl aber kalkulierte der Präsident in der Hoffnung, dass es genau zu dieser Eskalation kommt. Dahinter steht die entgegengesetzte Erwartung, dass sich die Republikaner damit nämlich ins politische Abseits schießen werden, weil die Bürgerinnen und Bürger den Streit leid sind und keine erfolgreiche Wiederauflage des Tea Party-Populismus ansteht. Ob beide Seiten die unterschiedlichen Erwartungen testen wollen, ist noch ungewiss.
Möglicherweise werden die Republikaner aber auch mit ruhiger Hand reagieren. Sie können dem Präsidenten das Leben durch Nadelstiche gegen seine Politik schwer machen. Das aber ist nur im Washingtoner Raumschiff von meinungsprägender Bedeutung. Politik – zumindest die öffentliche Meinung mit Massenwirkung erreichende Politik – lässt sich so nicht machen.
Und die anderen?
Da es Präsident Obamas Ziel war, sein Image aufzupolieren und den hispanischen Wählerblock zu sichern, muss er nun zwei Fallgruben fürchten. Die erste hat er sich selbst ausgehoben, indem er sechs Jahre lang in immer neuen Worten erklärt hat, dass er das, was er jetzt tat, eigentlich nicht tun dürfe.
Er sei nicht der Imperator der USA, formulierte er, um seine Untätigkeit zu entschuldigen. Die Formulierung war vielleicht ehrlich gemeint, aber unglücklich. Die Bilder – Obama mit Kaiserkrone und als Caesar – hängen ihm jetzt an.
Mal sehen, ob er noch eine bessere Erklärung dafür liefert, warum er erst jetzt mit dieser Anweisung an seine Verwaltung hervorkommt. Das hätte den Menschen, die er jetzt anspricht, sechs ruhigere Jahre bringen können. Von links wird diese Frage schon widerspenstig gestellt.
Die zweite Fallgrube
Gleichzeitig wird die zweite Fallgrube ausgehoben: Denn es werden etwa fünf Millionen irreguläre Migranten von Obamas Verwaltungsanordnung profitieren können. Bei einer geschätzten Gesamtzahl von über 11,5 Millionen heißt das aber auch: 6,5 Millionen irreguläre Migranten sind nicht erfasst.
Dieser Umstand hat auch damit zu tun, die Direktive juristisch wasserdicht zu machen. Aber das ist politisch nicht ausschlaggebend. Schon haben die ersten Initiativen angekündigt, Präsident Obama zu einer Regulierung für diese Menschen aufzufordern. Wenn diese Frage „Was ist mit den anderen und denen, die jetzt noch kommen?“ zum dominanten Fokus wird, könnte Obama rasch in die Defensive geraten.
Der Glücksmoment, den Republikanern ein treffliches Schnäppchen geschlagen zu haben und sie ohnmächtig schäumen zu sehen, könnte dann schneller verfliegen, als es dem Präsidenten lieb sein kann.
Wie weiter?
So tun sich für die nächsten Wochen und Monate drei Wege auf. Dem Präsidenten wäre es wohl am liebsten, er behielte kommunikativ die Oberhand und die Republikaner würden irgendwann verstehen, dass sie wenig ändern können.
Wenn diese hingegen ebenfalls einen Kurs der Konfrontation wählen, kommt es darauf an, ob sie sich damit als politische Hasardeure darstellen oder ob es ihnen gelingt, erneut eine populistische Bewegung aus der Traufe zu heben.
Von links wird Obama erinnert werden, dass er zu wenig zu spät getan hat. Ob dies in der öffentlichen Meinung durchdringt, bleibt abzuwarten. Die politische Entscheidung ist gefallen; die Konkurrenz darum, wie man sie zu verstehen hat, ist eröffnet.
Quelle: